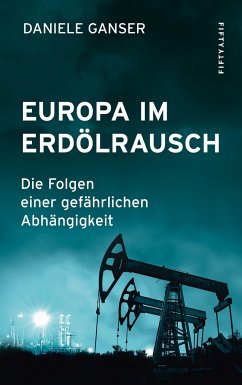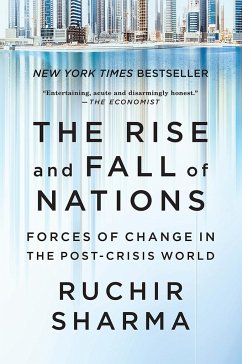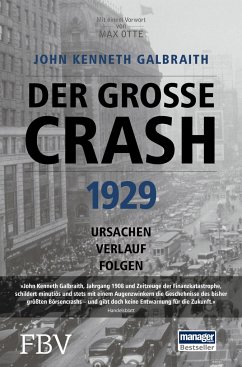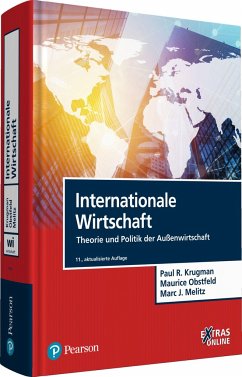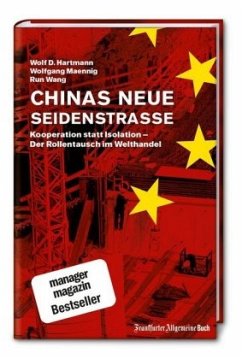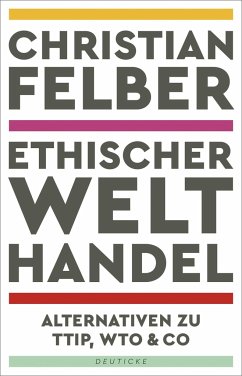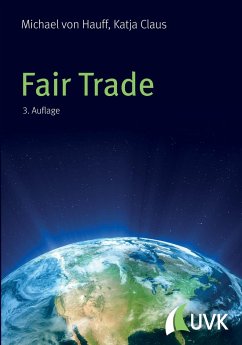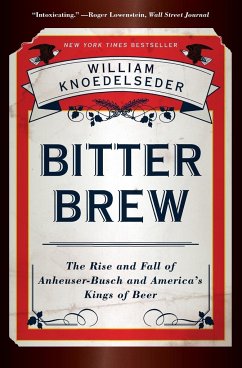der Verarbeitung dann wieder zum Ursprungsort verschifft wird.
Handel mit landwirtschaftlichen Gütern - vor allem Saatgut, Stecklinge, einzelne Tiere für die Züchtung oder landwirtschaftliche Technologie - über große Entfernungen wird schon seit Tausenden von Jahren betrieben, aber erst seit ungefähr zweihundert Jahren wurde weltweiter Handel mit den oft voluminösen Endprodukten landwirtschaftlicher Produktion lohnenswert.
Die Globalisierung des Handels mit Agrargütern verlief seither allerdings recht stockend, insbesondere nach dem Ende der Kolonialzeit. Trotz der Öffnung vieler Märkte in den vergangenen Jahrzehnten, ist der Agrarsektor immer noch weniger stark globalisiert als andere Sektoren. Der Grund dafür dürfte sein, dass in ihm die Folgen der Globalisierung im Positiven wie im Negativen besonders deutlich werden und protektionistische Impulse immer noch sehr stark sind. Die Globalisierung dieses Sektors hat zweifellos zum Wachstum der Ernten und der besseren Ernährungssicherheit der Weltbevölkerung beigetragen. Doch andererseits sind die Kosten für Umwelt und gesellschaftliche Strukturen - wie etwa die Entvölkerung des ländlichen Raums - alles andere als vernachlässigbar, und es bestehen ernsthafte und berechtigte Zweifel an der Nachhaltigkeit des modernen Ernährungssystems.
Die Vernetzung der globalisierten Lieferketten wird besonders deutlich bei verarbeiteten Lebensmitteln, deren Haltbarkeit längere Transportwege erlaubt. Der französische Journalist Jean-Baptiste Malet geht in seinem Buch den weitverzweigten Produktionswegen eines wenig glamourösen Nahrungsmittels nach: verarbeiteten Industrietomaten, denen wohl kaum ein Verbraucher entgehen kann, denn sie stecken in Tomatenmark, Pizzasauce, Tomatensaft und Ketchup.
Die Vereinigten Staaten, China und Italien sind die weltweit größten Produzenten von Tomatenkonzentrat. Malets Schilderung konzentriert sich auf China, Afrika - wo Chinas Agrarindustrie seit Jahren große Investitionen tätigt - und Italien, wo Flüchtlinge aus Afrika einen beträchtlichen Teil der Erntearbeiter ausmachen. China investiert seit den neunziger Jahren enorm in den Agrarsektor. Die Pioniere waren italienische Händler und Anlagenbauer, die halfen, innerhalb nur weniger Jahre die chinesischen Produktionskapazitäten enorm zu steigern. In China existiert jedoch kaum Bedarf für verarbeitete Tomaten, und ein Großteil der Produktion wird nach Italien, in andere europäische Länder und die Vereinigten Staaten exportiert. Dort wird das Tomatenkonzentrat dann zu Tomatenmark, Saucen oder Ketchup veredelt, im heimischen Markt verkauft oder reexportiert.
Einer der wichtigsten Exportmärkte für Tomatenmark aus chinesischem Konzentrat ist Afrika. Dort konkurrieren italienische, chinesische, indische und einige wenige einheimische Unternehmen aggressiv um Marktanteile. Die frühere Dominanz italienischer Exporteure wird seit den neunziger Jahren durch Unternehmen aus China herausgefordert. Sie erkannten, dass Lieferketten manchmal auch zu umständlich sein können und der Umweg über Italien eigentlich überflüssig ist. Heute hat China bei Tomatenkonzentrat in Afrika einen Marktanteil von siebzig Prozent.
Viele politische Debatten zur sogenannten Governance der Nahrungsmittelproduktion versuchen die Rolle von Landwirten zu stärken. Dies ist lobenswert, aber Malets Buch zeigt, dass die verwundbarste Gruppe oft rechtlose Erntearbeiter sind. Neben den Unternehmenssitzen der italienischen Tomatenverarbeiter sucht Malet auch die berüchtigten Lager mit nicht angemeldeten, meist afrikanischen Erntearbeitern in Apulien auf. Er beschreibt die erbärmlichen Verhältnisse in diesen Lagern und stellt die zentrale Rolle der sogenannten Caporali dar, die den Produzenten die Arbeitskräfte zuführen und sich illegal den entsprechenden Arbeitsmarkt angeeignet haben. Während in manchen Branchen Handelsketten verstärkt versuchen, Verantwortung für Arbeitsbedingungen in Produktionsstätten zu übernehmen, zeigt Malets Schilderung, dass im Lebensmittelsektor diese Problematik von Händlern und Verbrauchern bisher weitgehend ignoriert wird.
Auch der Endverbraucher kann als Benachteiligter dieses Systems gesehen werden. Die Konkurrenz von unterschiedlichen Produkten und die Präferenzen der Verbraucher sollten die Marktdynamik bestimmen. Doch wenn es um verarbeitete Tomaten geht, bleibt die Differenzierung der Produkte hauptsächlich auf die Verpackung beschränkt. Malets Reportagen zeigen, dass in den meisten Konserven, die weltweit in Supermärkten verkauft werden, das gleiche Produkt steckt. Ein oligopolistisch organisiertes Produktionssystem bietet nur den Anschein der Wahl, indem es Produkte auf den Markt bringt, die lediglich verschieden "gebrandet" sind.
Eine Stärke des Buches ist, dass der Autor seine Beobachtungen weitgehend für sich selbst sprechen lässt und sich mit eigenen Urteilen zurückhält - mit Ausnahme einiger recht allgemein gehaltener kapitalismuskritischer Aussagen. Allerdings bleibt der Leser auch ein bisschen ratlos zurück. Es wird zwar deutlich, dass das vorgestellte System die Weltmärkte dominiert, aber es bleibt offen, ob es funktionsfähige, umsetzbare Alternativen gibt. Als Diagnose ist Malets Buch aber zweifellos ungemein lesenswert.
THOMAS WEBER
Jean-Baptiste Malet: "Das Tomatenimperium". Ein Lieblingsprodukt erklärt den globalen
Kapitalismus. Aus dem Französischen
von Norma Cassau. Eichborn Verlag, Köln 2018. 288. S., br., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.06.2018
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.06.2018