Graf Kessler ist der Harry Potter des deutschen Bildungsbürgertums - oder zumindest jener Intellektuellen, deren Gegenwartsbeschreibungen meistens zu Verlustanzeigen werden und deren Hoffnungen, spätestens seit dem EU-Beitritt der mittel- und osteuropäischen Staaten, darauf hinauslaufen, daß das neue Europa dem alten möglichst ähnlich sehen möge, dem Europa der Belle Époque, des Fin de siècle, jener Welt, die im Ersten Weltkrieg unterging, der Welt von Harry Graf Kessler, dem Zauberer.
Harrypotterhaft an diesem Grafen war nicht nur das Tempo, mit dem er sich durch diese Welt bewegte - heute Berlin, morgen Paris, übermorgen London und gleich wieder zurück, so als reiste er auf dem fliegenden Besen und nicht mit der Eisenbahn (über die er sich niemals beschwert, was Kesslers Tagebücher auch zu einer Pflichtlektüre für den Herrn Mehdorn macht). Harrypotterhaft, also übermenschlich, waren generell die Möglichkeiten dieses Mannes, was allerdings weniger mit Magie als mit einem sehr großen Vermögen zusammenhing. Und harrypotterhaft ist nicht zuletzt die Rezeption, die in Kesslers Welt eine Magie vermutet, welche die Harry-Potter-Gemeinde in jenem Zauberreich gefunden hat, welches für die Uneingeweihten immer unsichtbar bleibt.
Harry Kessler, um den Helden kurz einmal vorzustellen, war ein Graf von zweifelhafter Legitimität - der alte Kaiser Wilhelm hatte sich, fast achtzigjährig, in Harrys schöne und sehr bürgerliche Mutter, eine irische Offizierstochter, verguckt; was dazu führte, daß Harrys bürgerlicher Vater, allen Standesregeln zum Trotz, eines Tages ein Graf war; Bankier blieb er aber im Hauptberuf, und als er starb, waren genügend Mittel vorhanden, um den Sohn vom Zwang zu regelmäßiger Arbeit zu befreien. Harry Graf Kessler studierte Jura, interessierte sich aber mehr für die Künste, und wenngleich er ein paar Jahre lang die Kunstzeitschrift "Pan" herausgab, eine Zeitlang als Museumsdirektor und auch als Diplomat arbeitete, bestand, zumindest in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, seine wesentliche Tätigkeit darin, unterwegs zu sein und berühmte Leute zu treffen. Und daß er siebenundfünfzig Jahre lang mit großer Disziplin das Protokoll dieser Reisen und Begegnungen in sein Tagebuch schrieb, hatte offenbar mit dieser sehr flüchtigen Existenz zu tun: Zwischen dem 1. Januar und dem 1. Februar 1912 war, nur zum Beispiel, Kessler in London, in Paris, in Bremen und wieder in Paris, traf Max Reinhardt, Edward Gordon Craig, George Bernard Shaw, Gabriele D'Annunzio, Aleister Crowley, Henry van de Velde, und man kann sich ganz gut vorstellen, daß ihm das alles zum sozialen und kommunikativen Rauschen wurde, aus welchem sich erst im Moment der Niederschrift ein paar klare Stimmen und präzise Konturen herausschälten.
Als neulich die ersten Bände des Tagebuchs erschienen, waren sich die meisten Rezensenten einig darin, daß hier das bedeutende Werk eines bedeutenden Mannes vorliege; man raunte und schwärmte und fand ganz generell bei Kessler, was man in der Gegenwart vermißte. Karl Schlögel, im "Merkur", entdeckte in den Reiserouten Kesslers den Fahrplan für das Europa des 21. Jahrhunderts und in seinem Kunstsinn die Antithese zum Subventionsbetrieb der Gegenwart: "Er brauchte für seine Aktivitäten nicht das Geld anderer Leute. Und wenn er in Europa unterwegs war, ging es ohne Stipendien und Fellowships" (als ob das bei ähnlich reichen Kunstfreunden unserer Tage, bei Gunter Sachs oder der Fürstin von Thurn und Taxis anders wäre). Und Fritz J. Raddatz, in der "Zeit", fand Kesslers Weltrang schon darin bestätigt, daß bei ihm am Tisch Albert Einstein neben Josephine Baker saß (hat Raddatz jemals die "Bunte" gelesen?). Und wenn man von all diesen Artikeln den Stuß abklopfte, bis nur noch das nackte Mauerwerk blieb, dann zeigte sich eine tiefe Sehnsucht danach, daß ein neues deutsches Bürgertum den Glanz, den Geist und die Bildung jener Zeit wiedergewinnen möge, so wie man, angeblich, auch barocke Schlösser und Fachwerkzeilen "wiedergewinnen" kann.
Einer schrieb, Kessler habe, nach ersten Lehrjahren in Paris und Ascot, in Hamburg "natürlich das Johanneum" besucht; ja klar, der Geist, die Bildung, das Bürgertum - und als Gegengift gegen solche Geschichtsvergessenheit taugt ganz gut Laird M. Eastons Biographie Kesslers, "Der Rote Graf", die soeben auf deutsch erschienen ist. Das liegt nicht nur daran, daß Easton in Kalifornien lebt, weit weg also vom Geschichtspomp und dem Bürgerlichkeitsgefasel der sogenannten Berliner Republik. Es liegt vor allem daran, daß, wer Kesslers Tagebücher liest, zwangsläufig alles überliest, was ihm trivial und uninteressant erscheint, und letztlich eben genau das findet, was er von vorneherein gesucht hat. In der Zusammenschau von Easton dagegen entsteht ein ganz anderes Bild: "Natürlich das Johanneum" - das sieht bei Easton so aus, daß der junge Kessler aus Ascot kam, wo er sich zwar schwergetan hatte, Freunde zu finden; aber daß man dort alles lernte, was man brauchte, um ein Gentleman zu werden, also Haltung und Härte, Stil, Geschmack und genügend Widerspruchsgeist, um sich notfalls auch gegen eine gewaltige Mehrheit zu stellen, das hatte Kessler offenbar eingeleuchtet. Das deutsche Gymnasium dagegen blieb ihm unverständlich: "Wir wußten nur, daß das Ziel unserer Schulung war, uns zu ,gebildeten Menschen' zu machen, und die Pflicht uns daher auferlegt war, mit rastlosem Fleiß uns Tag und Nacht zu bilden. Was aber der Inhalt oder gar der Zweck dieser so heftig umworbenen ,Bildung', dieses verschleierten Götterbildes, war, blieb unklar." Klarer als seine Anbeter, mehr als hundert Jahre später, sah Kessler, daß Bildung im Wilhelminischen Deutschland nicht Erziehung zu Verantwortung und Selbständigkeit war. Sondern bloß der Ersatz dafür.
Harry Graf Kessler war - wie der soeben erschienene vierte Band seiner Tagebücher zeigt, die Aufzeichnungen aus den Jahren 1906 bis 1914 - alles andere als der Repräsentant seiner Epoche; er war noch nicht einmal deren Held und Ideal. Er war die Ausnahme, und heute sieht man, daß er, was seine Lebenspraxis angeht, die Avantgarde war, seiner Zeit um ein Jahrhundert voraus. Mittags Berlin, Lunch im Borchardt mit Reinhardt und Hofmannsthal, nachmittags Weimar, am nächsten Tag ab nach Paris: . . . und die Frisur hält, möchte man hinzufügen, weil es nach der Werbung für Drei-Wetter-Taft klingt und mehr mit den ortlosen Existenzen unserer Tage zu tun hat, mit den Menschen, die man in einer Frequent Traveller Lounge trifft oder im sogenannten Sprinter der Deutschen Bahn; der Rhythmus der Belle Époque war viel gemächlicher.
Diese Raserei produziert eine Menge Stillstand, es geht, von 1906 bis 1914, immer wieder und immer gleich, hin und her zwischen Berlin, Paris und London, mit gelegentlichen Abstechern nach München, Wien, in den Süden, und als im Sommer 1908, nach einer Reise durch Griechenland, das Tagebuch einmal abbricht und Kessler nur kurz notiert, daß er seit acht Tagen krank in Rom liegt, da fragt man sich, ob er sich nicht bewege, weil er krank sei, oder ob er erst richtig krank geworden sei von acht Tagen ohne Ortswechsel. Was man ihm aber sofort glaubt, auch wenn es nicht sympathisch wirkt, das ist seine Erleichterung darüber, daß der Weltkrieg ihn zur Aufgabe dieses Lebensstils zwingt. Er weiß jetzt, in den Tagen des Ultimatums und der Mobilmachung, wo er hingehört: zu seinem Regiment. Und er, der Ende Juli in London mit dem Premierminister gefrühstückt hat und ein paar Tage später in Paris zu Mittag gegessen, notiert am 3. August 1914 in sein Tagebuch, daß der Krieg entweder Deutschlands Weltherrschaft bringen werde. Oder aber den Untergang. Damit endet das Tagebuch; der nächste Band wird erzählen, wie Kessler erst zum großen Krieger und dann zum Pazifisten wurde.
Der vorliegende Band aber erzählt von einem, den wir heute einen Jet-setter nennen würden, und entsprechend ist auch der Stil: viel name-dropping, schicke Orte, reiche Menschen, eine Wirklichkeitsmitschrift im Dauerpräsens; es klingt oft wie Pop-Literatur avant la lettre, wie der frühe Bret Easton Ellis, nur ohne den Sex, die Gewalt, die Drogen. Und so wie Patrick Bateman, der Killer aus "American Psycho", der ständig mit anderen verwechselt wird, so scheint auch Kessler einen Drang ins Unsichtbare zu haben: Mit Hofmannsthal im Adlon, mit D'Annunzio auf den Champs-Elysées, mit Reinhardt im Borchardt - das klingt, ohne daß es sich belegen ließe, manchmal nach der Verzweiflung des Mannes, dessen Rolle im Kulturbetrieb vor allem darin besteht, daß er für die ganze Runde die Zeche zahlt.
CLAUDIUS SEIDL
Harry Graf Kessler: "Das Tagebuch. Vierter Band 1906 - 1914". Herausgegeben von Jörg Schuster. Cotta-Verlag, 1270 Seiten, 63 Euro.
Laird M. Easton: "Der Rote Graf". Übersetzt von Klaus Kochmann, Klett-Cotta, 574 Seiten, 39,50 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
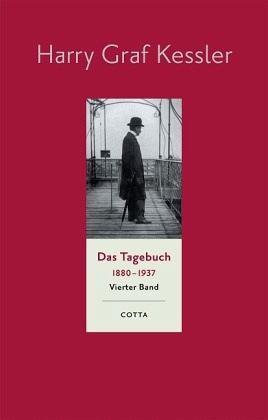





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.12.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.12.2005