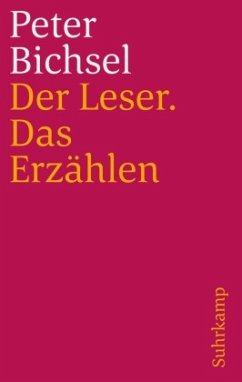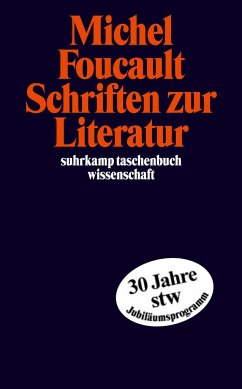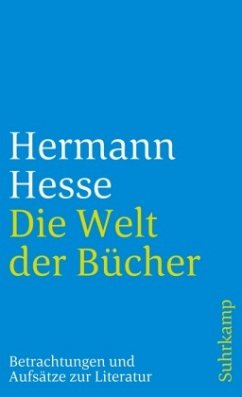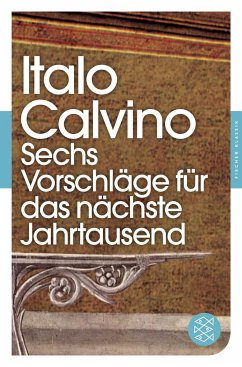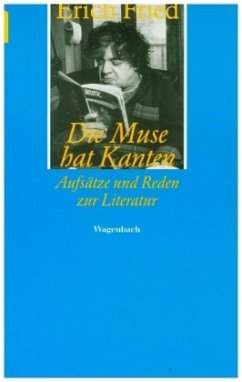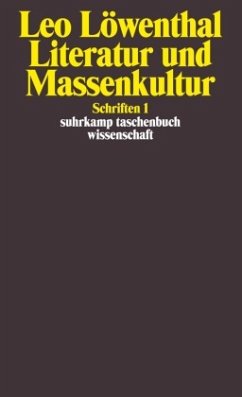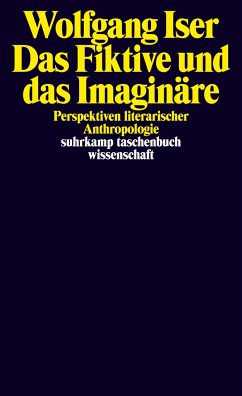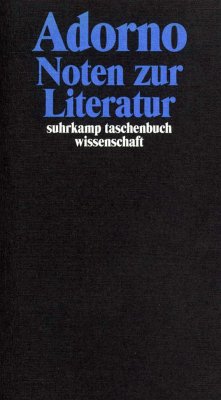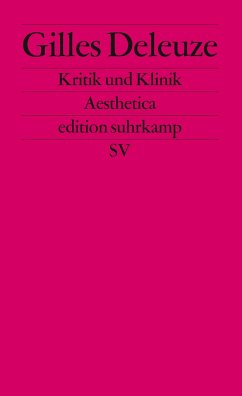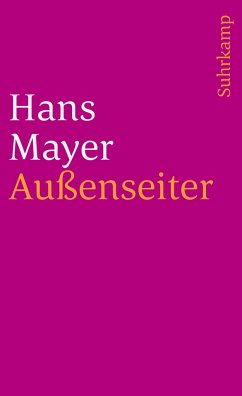Das süße Gift der Buchstaben
Reden zur Literatur. Originalausgabe
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
8,50 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Zwischen 1983 und 2003 hat sich Peter Bichsel nicht oft, dafür aber dann, wenn es geschah, um so prägnanter in öffentlichen Reden mit Autoren und anderen nicht unbekannten Menschen, die es mit Büchern zu tun haben, auseinandergesetzt. Und immer sind dabei Texte entstanden, die von der Lust am Lesen erzählen, von der gefährlichen Leidenschaft, ja unheilbaren Sucht, Buchstaben, Wörtern und Sätzen verfallen zu sein. In seinen Reden über die Eröffnung einer Buchhandlung, zu einem Geburtstag des Verlegers Siegfried Unseld, über Jean Paul, Gottfried Keller und Peter von Matt zeigt Peter B...
Zwischen 1983 und 2003 hat sich Peter Bichsel nicht oft, dafür aber dann, wenn es geschah, um so prägnanter in öffentlichen Reden mit Autoren und anderen nicht unbekannten Menschen, die es mit Büchern zu tun haben, auseinandergesetzt. Und immer sind dabei Texte entstanden, die von der Lust am Lesen erzählen, von der gefährlichen Leidenschaft, ja unheilbaren Sucht, Buchstaben, Wörtern und Sätzen verfallen zu sein. In seinen Reden über die Eröffnung einer Buchhandlung, zu einem Geburtstag des Verlegers Siegfried Unseld, über Jean Paul, Gottfried Keller und Peter von Matt zeigt Peter Bichsel, wie ernst und zugleich undogmatisch er mit Büchern umgeht und was ihm die "Solidarität der Leser" bedeutet: angesichts einer Lektüre mit jemandem zusammenzusein.