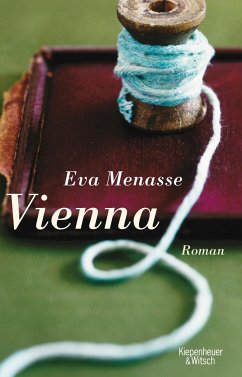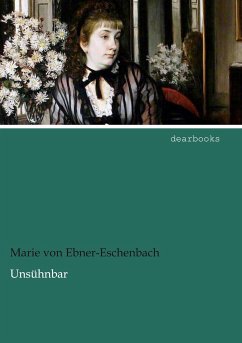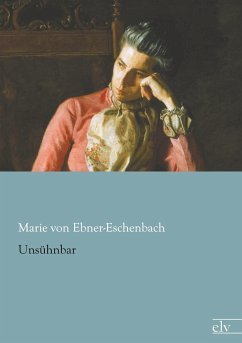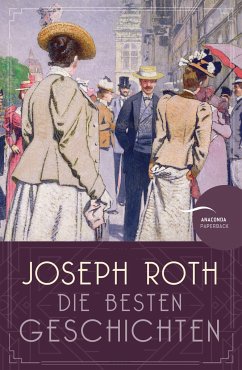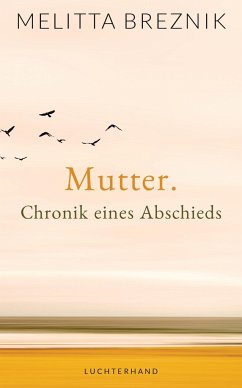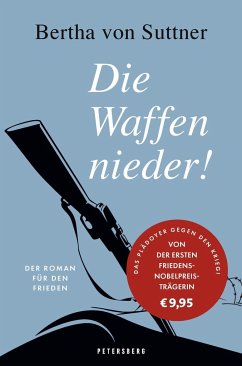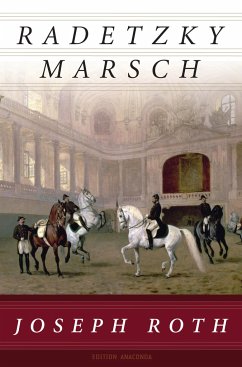Nicht lieferbar
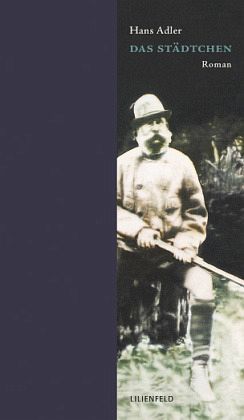
Das Städtchen
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Herr von Seylatz soll in einem österreichischen Provinznest eine Zwischenstufe in seiner Beamtenkarriere absitzen, aber er hat vor, das beste daraus zu machen. Phantasien von einfachen Kleinstadtmädchen werden wach, und immerhin wohnt auch sein alter Freund Titus Quitek hier, einst ein vielversprechendes Malertalent, jetzt Zeichenlehrer an der hiesigen Realschule. Schon bei der ersten Begegnung wirkt Quitek allerdings merkwürdig unglücklich und zerzaust ... Um das Schicksal dieses gescheiterten Künstlers herum tut sich bald ein ganzes Panorama menschlichen Daseins auf. Vom Bürgermeister ...
Herr von Seylatz soll in einem österreichischen Provinznest eine Zwischenstufe in seiner Beamtenkarriere absitzen, aber er hat vor, das beste daraus zu machen. Phantasien von einfachen Kleinstadtmädchen werden wach, und immerhin wohnt auch sein alter Freund Titus Quitek hier, einst ein vielversprechendes Malertalent, jetzt Zeichenlehrer an der hiesigen Realschule. Schon bei der ersten Begegnung wirkt Quitek allerdings merkwürdig unglücklich und zerzaust ... Um das Schicksal dieses gescheiterten Künstlers herum tut sich bald ein ganzes Panorama menschlichen Daseins auf. Vom Bürgermeister bis zur Prostituierten: gleichermaßen humorvoll-leichtfüßig wie düster-realistisch verwebt Hans Adler die Leidenschaften und Sehnsüchte, die erotische Gier, die Kaltblütigkeiten und das Durchwursteln aller Schichten dieses Provinzortes. Hans Adler erhielt für dieses Buch 1927 sofort den Künstlerpreis der Stadt Wien. 1947 erschien "Das Städtchen" zuletzt - und das ist viel zu lange her für diesen ganz besonderen, unterhaltsamen und tiefsinnigen Roman.