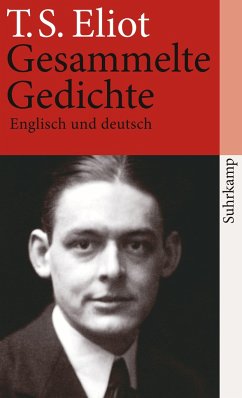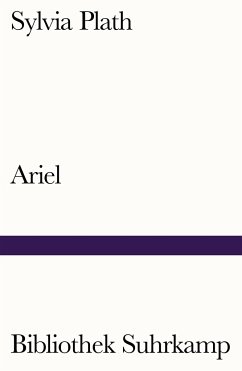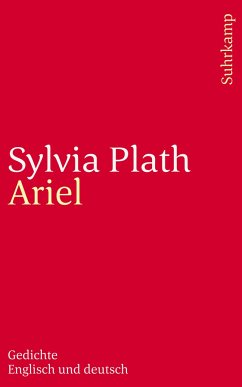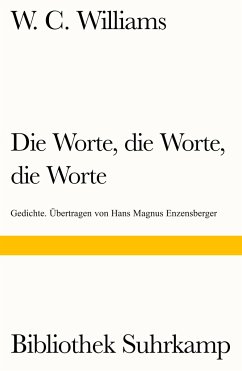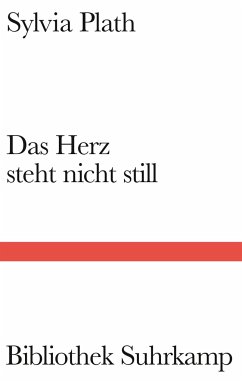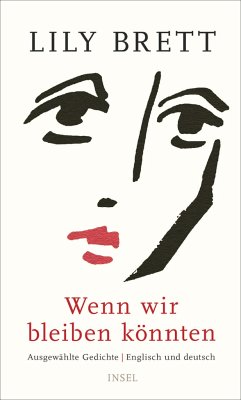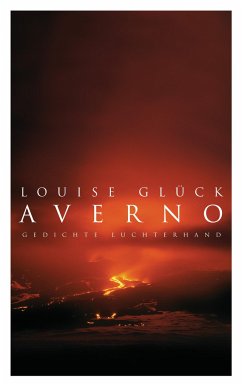Das öde Land
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
20,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
»Verschiedene Kritiker haben mir die Ehre angetan, das Gedicht als Kritik an der Gegenwart zu interpretieren, und haben sogar eine gehörige Portion Gesellschaftskritik hineingelesen. Für mich war es nur das Ventil für einen privaten und ganz belanglosen Grant gegen das Leben; es ist lediglich ein Stück rhythmischer Quengelei.« So wehrt ein Autor, ebenso verständlich wie unangemessen und vergebens, den Ruhm ab, mit dem er für eben dieses Gedicht, The Waste Land, überhäuft worden ist. The Waste Land (erschienen 1922) ist das Langgedicht des 20. Jahrhunderts, jedenfalls das mit der grö...
»Verschiedene Kritiker haben mir die Ehre angetan, das Gedicht als Kritik an der Gegenwart zu interpretieren, und haben sogar eine gehörige Portion Gesellschaftskritik hineingelesen. Für mich war es nur das Ventil für einen privaten und ganz belanglosen Grant gegen das Leben; es ist lediglich ein Stück rhythmischer Quengelei.« So wehrt ein Autor, ebenso verständlich wie unangemessen und vergebens, den Ruhm ab, mit dem er für eben dieses Gedicht, The Waste Land, überhäuft worden ist. The Waste Land (erschienen 1922) ist das Langgedicht des 20. Jahrhunderts, jedenfalls das mit der größten Wirkung in der westlichen Welt. Ein Blick in Norbert Hummelts schwungvoll rhythmische, "direkte" Neuübertragung und das Original macht ohne weiteres verständlich, warum.Der puritanischen Traditionslinie der amerikanischen Literatur - über Emerson, Thoreau, Dickinson und Whitman - folgend, bezieht Eliots bewußt fragmentarisch gehaltenes Krisengedicht den Leser geradezu szenisch mit ein. Es läßt ihnmitarbeiten, innehalten, überlegen: Selbsterforschung - des Lesers mehr als des Sprechenden - ist gefragt. Auch dies hat Das öde Land über all die Jahre hinweg lebendig gehalten.