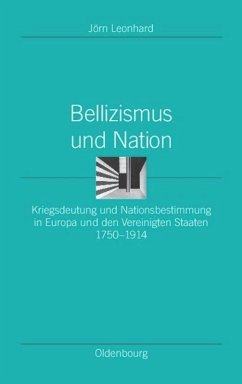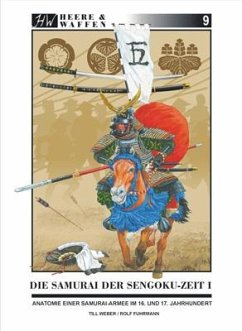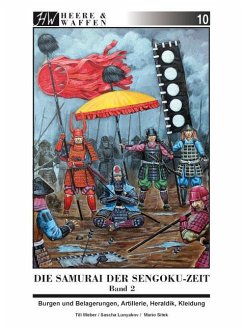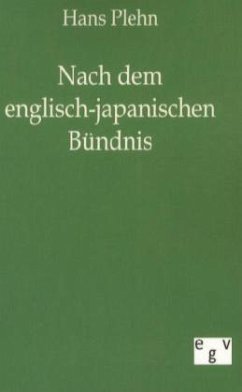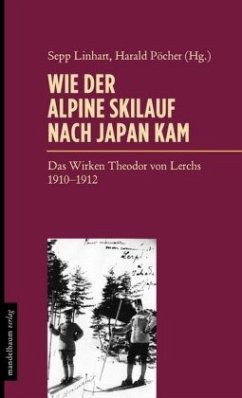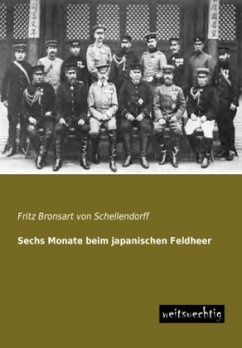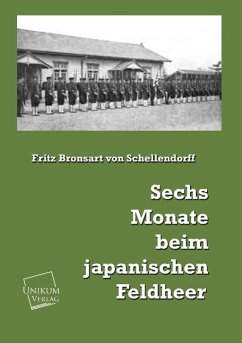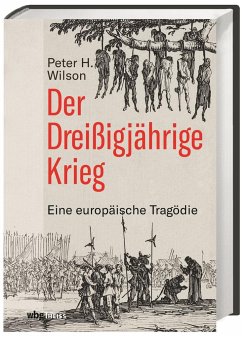Voraussetzungen für die strategischen und operativen Planungen der Militärs in einschneidender Weise. Der herausragenden Bedeutung dieser drei Jahrzehnte für den Aufbruch des Militärs in die Moderne sind die achtzehn Beiträge des vorliegenden Sammelbandes gewidmet. Sie behandeln die Auswirkungen des Wandels von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf Heer und Marine in Preußen-Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Rußland, Österreich-Ungarn und den Vereinigten Staaten; auch mit Japan befaßt sich ein Beitrag. Die intendierte vergleichende Betrachtung, die Differenzierung zwischen allgemeingültigen Entwicklungstendenzen und nationalen Besonderheiten, hat im wesentlichen der Leser zu leisten.
Hatte Clausewitz noch gemeint, bei den materiellen Kriegsmitteln seien "bei der Einfachheit und inneren Notwendigkeit, zu der alles gediehen ist", keine bahnbrechenden Neuerungen zu erwarten, so war diese Auffassung schon bald eindeutig widerlegt. Die in der Schlacht von Königgrätz 1866 demonstrierte Überlegenheit des preußischen Zündelnadelgewehrs führte dazu, daß binnen weniger Jahre in allen Armeen der Vorderlader durch das schnellfeuernde Hinterladungsgewehr ersetzt wurde. Eine weitere Gemeinsamkeit bei den kontinentalen Armeen bildet die allgemeine Wehrpflicht. Soweit sie noch nicht bestand, wurde sie eingeführt, wo sie bis dahin nur lückenhaft durchgeführt war, handhabte man sie jetzt rigoroser. Das Heer wurde damit gewissermaßen vergesellschaftet, endgültig traten Massenheere an die Stelle von Söldnerheeren, die Tendenz zur industrialisierten Massenkriegführung war evident. Im Unterschied zu den Staaten des Kontinents setzte Großbritannien ganz auf seine Flotte, mit der es jahrzehntelang eine imperiale Vorherrschaft ausüben konnte. Die Strategie zur "Verteidigung des Empire" stützte sich auf Nachrichtenverbindungen mit Unterwasserkabeln, Trockendocks und Kohlestationen in aller Welt sowie "Fliegende Geschwader" zum Schutz der britischen Handelsbeziehungen.
Eine weitgehende Übereinstimmung läßt sich beim Verhältnis zwischen Regierung und Militärführung konstatieren. In Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten bestand eine klare Unterstellung der Militärführung unter die Politik. Auch in Deutschland vermochte sich die Politik trotz vielfacher Spannungen mit der Militärführung durchzusetzen, ebenso in Österreich-Ungarn, obwohl der Generalstabschef Präventivkriegspläne schmiedete. In Rußland blieb die Grenzziehung zwischen Militär und Politik undeutlich, die Führung der reformierten Armee mischte sich unter Alexander II. stärker in die Politik ein.
Einen Sonderfall stellen die Vereinigten Staaten dar. Nach dem Ende des Sezessionskrieges wurden Heer und Flotte in atemberaubendem Tempo demobilisiert. Standen im Mai 1865 über eine Million Mann unter Waffen, so waren es Anfang der 1870er Jahre nur noch etwa 30 000 Mann, und das Militär stand in geringem Ansehen: Besatzungsarmee in den Südstaaten, kaltblütige Indianermörder im Westen und willige Streikbrecher in den östlichen Industrieregionen. Die Flotte schrumpfte von mehr als 700 Schiffen auf 150 im Jahr 1875, und Anfang der 1880er Jahre rangierte die amerikanische Flotte weltweit auf Platz zwölf. Doch 1882 begann mit dem Flottenbauprogramm die Modernisierung der Flotte, und zugleich wurde damit der Grundstein für den raschen Aufbau des amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes gelegt. Im Zeichen des "Neuen Imperialismus" erfuhren Armee und Marine eine deutliche Aufwertung. Es ist, wie diese knappen Bemerkungen nur andeuten können, ein buntes Kaleidoskop, das sich in den Beiträgen des Sammelbandes entfaltet.
Die Militärhistoriker sind sich weitgehend darin einig, daß nach 1870/71 ein großer europäischer Krieg kaum noch als durchführbar, weil nicht mehr kontrollierbar galt. Nur kleinere Kriege hätten die Militärs noch als möglich angesehen. In seiner letzten Rede im Deutschen Reichstag am 14. Mai 1890 beschwor der neunzigjährige Helmuth von Moltke, einer der erfolgreichsten Feldherrn des 19. Jahrhunderts, das unermeßliche Unglück, das ein europäischer Krieg über die Menschen bringen würde: "Wenn der Krieg, der jetzt schon mehr als zehn Jahre lang wie ein Damoklesschwert über unseren Häuptern schwebt - wenn dieser Krieg zum Ausbruch kommt, so ist seine Dauer und sein Ende nicht abzusehen, . . . es kann ein siebenjähriger, es kann ein dreißigjähriger Krieg werden - und wehe dem, der Europa in Brand steckt, der zuerst die Lunte in das Pulverfaß schleudert!" Diese düstere Prophezeiung sollte sich 1914 erfüllen, als der Kriegsausbruch die "Urkatastrophe" des 20. Jahrhunderts in Gang setzte.
EBERHARD KOLB
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
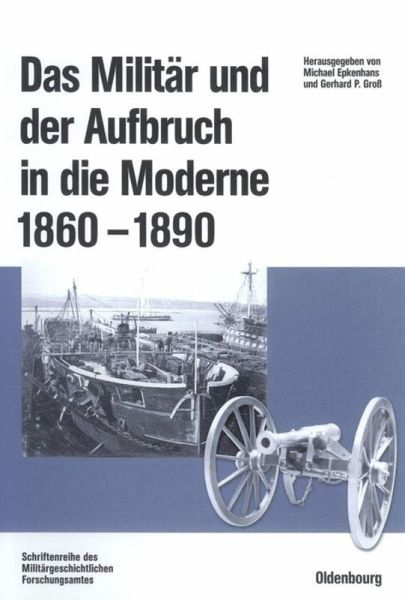






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.06.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.06.2004