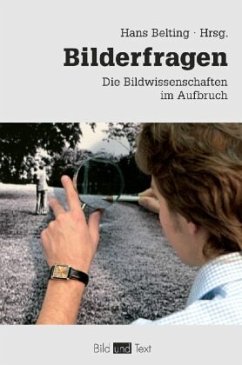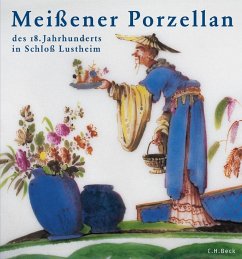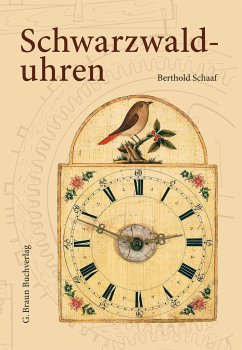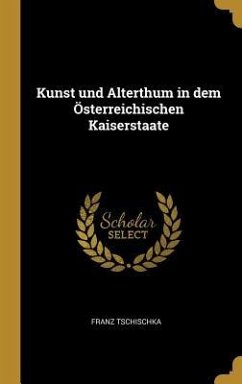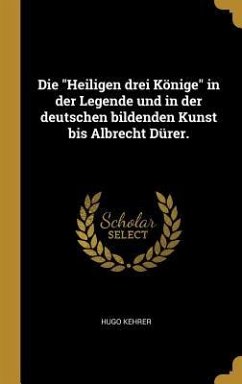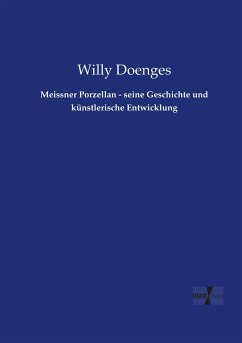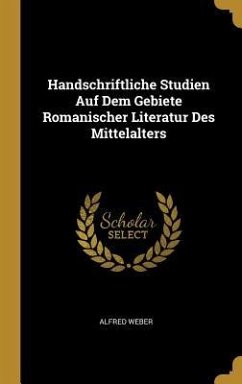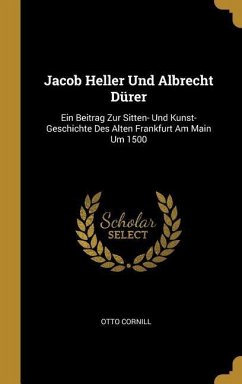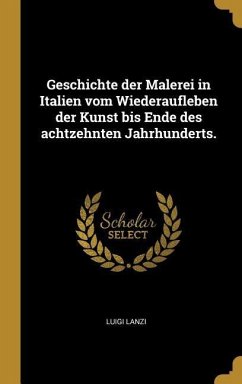das halbe Leben. Kunst aber sollte mehr sein als bloß ordentlich.
Das Wort "Tableau" verheißt da schon erlesenere Genüsse, weit verführerischer als schlichte Tabellen. Selbst wenn Michel Foucault das zur Ordnung gerufene Wissen des achtzehnten Jahrhunderts in Tableaus wiederfindet, umweht den Begriff der Hauch des Schönen. Nicht nur, weil Foucault diese Tableaus in einem Buch mit dem Titel Les mots et les choses vorstellt und das irgendwie reizvoller klingt als einfach nur "Sachen und Wörter"; sondern auch weil mit "Tableaus" durchaus jene Tafelbilder gemeint sein können, in denen der abendländische Kunstfreund seine Sehnsucht nach dem Innigsten oder dem Erhabensten kultiviert. Der schimmernde Dunst über den klassischen Landschaften Claude Lorrains, die dämonische Wirtshausfröhlichkeit eines holländischen Genremalers, sie eröffnen den Blick in komplette Makro- oder Mikrokosmen. In der Wissenschaft ist das Tableau die reduzierte Darstellung eines sachlogischen Zusammenhangs, in der Kunst die Beschwörung einer ganzen Welt.
Annette Graczyk rekonstruiert in ihrem Buch kenntnisreich und mit Liebe zum Detail, wie das literarische Tableau am Ende des achtzehnten Jahrhunderts beide Erbschaften zugleich antritt: das systematische Ordnungsbild, gipfelnd vielleicht in den Gewerbetafeln der großen französischen "Encyclopédie", auf denen ganze Industriezweige abgebildet sind, und die klassisch-romantische Landschaftskunst oder Genremalerei. Die Verwandlungen, denen diese Darstellungen auf dem Weg zum literarischen Tableau unterzogen werden, sind heikel. Denn was Abbildungen, ob dröge oder üppig, vor dem Betrachter gleichzeitig entfalten, muß die Literatur notgedrungen am Faden einander folgender Wörter aufziehen. Die Texte, die Graczyk untersucht, lavieren denn auch immer zwischen der Mühsal, den Eindruck des Simultanen zu erwecken, und der Flüchtigkeit der Rede. So reißt Denis Diderot in seinen Dramen die Zuschauer bisweilen aus der Illusion und läßt die Schauspieler zu einem sinnig gruppierten Ensemble erstarren, zu einem Tableau eben, in dem ein gelungenes Familienidyll festgehalten wird oder sich eine bevorstehende Katastrophe abzeichnet. Louis-Sébastien Mercier entrollt noch vor 1789 in Hunderten von charakteristischen Szenen ein bewegtes "Tableau de Paris", das der Leser doch nie zu einem Gesamteindruck zusammenfügen kann. In seinem Aufsatz "Granit" malt Goethe vom Gipfel des Brocken aus feierlich eine symbolische Weltlandschaft, um seine schwankende Psyche auf ein möglichst tiefgründiges Fundament zu stellen. Das Chaos des "Römischen Carnevals" sortiert er auf dem Schauplatz des Corso zu abgeschlossenen kleinen Bildern, die in keinem mehr einen Festestaumel auslösen. Und seine "Novelle" läßt Goethe zum guten Ende kommen, wenn Felstrümmer, Burgruine und Wald, Roß und Reiter, Jäger und Beute, Fürstin und fahrendes Volk, Löwe und flötender Knabe die Geschichte des Universums zum lebenden Tableau verkürzen - vielleicht war's aber auch nur eine Zirkusnummer.
Ein Höhepunkt des Genres ist mit Alexander von Humboldts "Naturgemälden" aus seinen "Ansichten der Natur" und dem späten "Kosmos" von 1845-1859 erreicht, in denen wissenschaftliche Genauigkeit und künstlerischer Anspruch um die literarische Erschließung der ganzen Welt wetteifern. Der Arzt und Maler Carl Gustav Carus gibt mit seinen "Erdlebenbildern" eine romantischere Variante zu diesen "Naturgemälden". Mit ihrer schönen Wissenschaft setzen sich Humboldt und Carus schon in den Augen mancher Zeitgenossen zwischen alle Stühle.
Warum war aber das literarische Tableau, obwohl es eigentlich eine Unmöglichkeit darstellt, von 1780 bis 1850 so gefragt? Die Autorin sucht die Antwort in einer epochalen Verzeitlichung der Wahrnehmung. Wenn zuvor Natur, Gesellschaft und Wissen als wesentlich stabile Zusammenhänge räumlich verteilter Erscheinungen verstanden wurden, so traten im späten achtzehnten Jahrhundert die Wandelbarkeit von Politik und Gesellschaft sowie die veränderliche Natur in den Vordergrund. Die Geologie, die Biologie, die Geschichtswissenschaft traten nun zur Erklärung von dynamischen Prozessen an. Dabei scheint die sichtbar gewordene Unbeständigkeit alles gleichzeitig Bestehenden die systematischen Ordnungsbilder wie die Malerei an ihre Grenzen getrieben zu haben. Wo es um die zeitliche Tiefenschärfe von "Totaleindrücken" ging, war die Stunde des literarischen Tableaus gekommen.
Das alles weist in sehr viele Richtungen und führt Verschiedenstes zusammen, wobei auch ein wenig Verwirrung entsteht. Literarische Tableaus erinnern an Register, Tabellen, Genealogien, Schemata, Profile und Schautafeln, an die "Camera obscura" und Kaufrufdarstellungen, an Panoramen und Dioramen, Veduten und Landschaften, Genrebilder und Stilleben; sie kommen im Drama vor, in der Novelle, im Gedicht, im Feuilleton und im Aufsatz, im Essay und im Tagebuch. Ja, ist denn etwa jede übersichtliche Darstellung eines komplizierten Zusammenhangs ein literarisches Tableau? Goethes Schrift über die "Metamorphose der Pflanzen" zum Beispiel sieht eigentlich gar nicht so aus wie ein Bild, sondern eher wie ein naturkundlicher Aufsatz in ziemlich vielen Paragraphen.
Graczyk entwirft ihr Spektrum literarischer Tableaus, indem sie sich auf fünf exemplarische Autoren aus Frankreich und Deutschland konzentriert. Andere Beispiele werden kaum genannt, und wir erfahren wenig über die Verbreitung des Phänomens oder triviale Varianten. Viel Interessantes ist da zu lesen von den wissenschaftlichen und künstlerischen Paten dieses Genres, wenig aber von seinen rhetorischen und poetischen Wurzeln. Gab es nicht seit je lobende und lehrende Gattungen, die singend und sagend die Vielfalt des Wissens zur Einheit des Schönen zusammenfaßten? Die vielen bündelnden und malenden Stilmittel der Dichtung, Metapher und Metonymie, Allegorie und Symbol - sie schwimmen in den Interpretationen der Autorin irgendwie mit und scheinen sie im übrigen nicht wirklich zu beunruhigen. So fügen sich die vielen aufschlußreichen Beobachtungen doch nicht zu einem übersichtlichen Totalgemälde. Nach zwei Seiten, zur Kunst und zur Wissenschaft hin, faßt Annette Graczyk das literarische Tableau mit einem soliden Rahmen ein, der manchmal durch Exkurse verschnörkelt ist. An den anderen Rändern zerfasert das Bild. Die Faszination bleibt, wie bei allem, was schön und klug zugleich ist.
BETTINA HEYL
Annette Graczyk: "Das literarische Tableau zwischen Kunst und Wissenschaft." Wilhelm Fink Verlag, München 2004. 474 S., geb., 49 Abb., 68,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
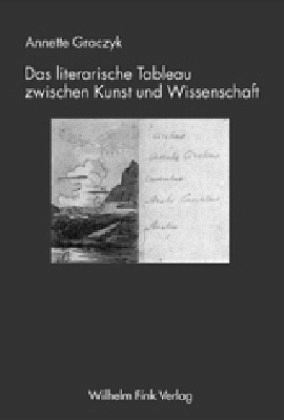




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.04.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.04.2005