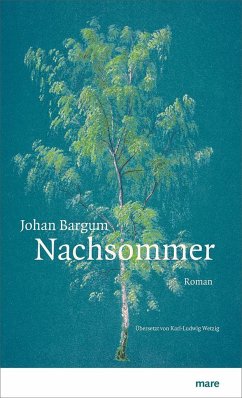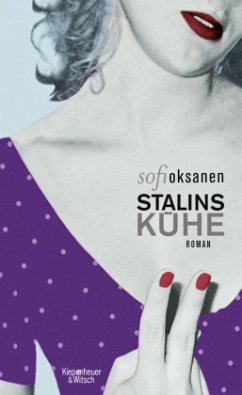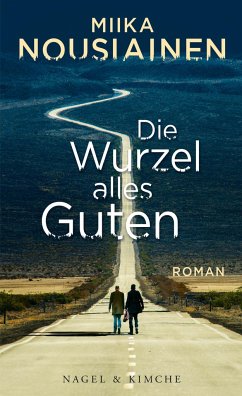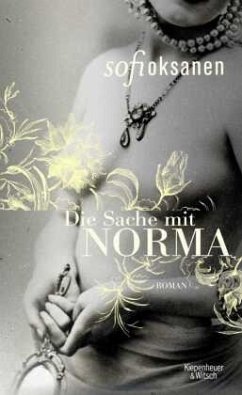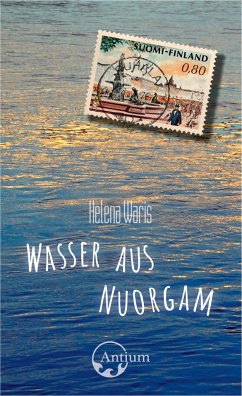Er ist dabei so stark auf Blickwinkel und Bewusstseinshorizont seiner Figuren fokussiert, dass eine Geburt, ein Sterbefall, ein Hausbau im Familienkreis wichtiger ist als der Bürgerkrieg 1918 oder der Rücktritt von Präsident Kekkonen 1981. Geschichte ist bei ihm zuerst Familiengeschichte, und das heißt im Haus der Fotografenfamilie Löytövaara immer auch: Familiengeheimnisse, Heimlichkeiten in der Dunkelkammer, die sich den Kindern allenfalls im Nachhinein und manchmal nie erschließen. Das Leben ist ein fadenscheiniges Gewebe voller Löcher, Lücken und Leerstellen, und weil Finnland eine der tragenden Säulen des European Song Contests ist, überschreibt Kinnunen alle Kapitel mit den Titeln von finnischen Schlagern, Kinder- und Kirchenliedern. Am Anfang heißt es "Schlafen gehen wir nicht", am Ende: "Zerbrochen ist der Traum vom Glück".
In seinem gefeierten Erstling "Wege, die sich kreuzen" (2014) stellte Kinnunen einige Mitglieder seiner Familie vor, die jetzt auch in seinem zweiten Roman wieder auftauchen, etwa die Fahrrad fahrende Hebamme Maria und ihre harte, verbitterte Tochter Lahja. Damals, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, hausten die Menschen in Lopotti, dem Kaff im Nordosten Finnlands, noch in Erdlöchern, und was damals ein gut gehütetes Familiengeheimnis war, liegt jetzt, aus einer anderen Perspektive erzählt, ziemlich offen zutage: Onni, Lahjas Mann, war "anders als die Anderen", einer, der teuer für sein heimliches Laster bezahlte. Auch sein Enkel Tuomas leidet noch unter Homophobie und Diskriminierung; deshalb flüchtete er in die Anonymität Helsinkis und versucht als Anlageberater, das Verbotene im Schutz der Rationalität von Geld und Zahlen ausleben zu können. Kinnunen beschreibt sehr einfühlsam das Versteckspiel eines Schwulen im prüden Finnland der Sechziger, seine Emanzipation in den Clubs, Saunen und der Abba-Popkultur der Achtziger, seinen erneuten Rückzug ins Private in Zeiten von Aids.
Sie wollten normal sein, doch man ließ sie nicht
Am Ende, gerade als er in Osku doch noch einen Mann fürs Leben findet, wird Tuomas noch einmal von der überwunden geglaubten Homophobie eingeholt: Die Frau, die das Wunschkind der beiden schwulen Väter zur Welt bringen sollte, bricht nach der Geburt plötzlich alle Kontakte ab. Zurück bleiben zwei alte Schwule am Rande der Gesellschaft, geduldet, einsam und desillusioniert. Sie wollten "normal" sein, eine Familie gründen, aber man ließ sie nicht.
Jahrzehnte vorher hatte auch Tuomas' blinde Tante Helena mit Vorurteilen und unsichtbaren Hindernissen zu kämpfen. Blinde galten in Lopotti als bemitleidenswerte Kreaturen, wenn nicht geistig behinderte Deppen. "Wenn man blind ist, darf man nicht noch auf andere Weise seltsam sein, denn die normalen Menschen mögen es nicht, zu andersartige Leute zu sehen", schreibt Helena ihrem kleinen Bruder. "Merkwürdig darf man nur sein, wenn man schwachsinnig ist, denn von denen erwartet niemand etwas." Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg geboren, half Helena noch ihrer Hebammen-Oma beim Entbinden und ihrem unglücklichen Vater beim Bilderentwickeln und Retuschieren in der Dunkelkammer. Auf der Blindenschule und im Konservatorium zum "nützlichen Mitglied" der Gesellschaft erzogen, durfte sie als "sehbehinderte Fachkraft" Klaviere stimmen und spielen. Sie wollte wie alle eine Familie haben, aber dann kamen Fehlgeburten, Abtreibungen, und irgendwann verließ ihr Mann sie für eine Sehende. Als neugieriges, mutiges Mädchen hatte sie immer geglaubt: "Ich brauche nichts, was ich nicht zu benutzen weiß. In meiner Welt fehlt nichts." Und: "Wir sind nicht auf der Welt, um am Rand zu stehen." Jetzt weiß sie: "Es ist anstrengend, nur für eine einzige Eigenschaft bekannt zu sein."
Familie ist etwas, von dem man sich nicht trennnen kann
Kinnunen schreibt in einer schlichten, präzisen, kitschfreien Sprache über Wahrnehmung, Lichtblicke und Ängste einer Blinden: Wie Helena sich mit Schrittzählen, Laufleinen und Phantasie im Raum orientiert, auf einer Blindenlandkarte das Heimatdorf mit Händen sucht und in Panik gerät, wenn sie sich auf der Straße plötzlich nicht mehr zurechtfindet; wie sie Musik körperlich erlebt, Stimmen synästhetisch scannt, Erinnerungsbilder "sieht" und das erste Mal im Bett erlebt. Weniger überzeugend ist die Engführung der beiden Außenseiterbiographien: Homosexualität und Blindheit sind doch sehr verschiedene Formen von Diskriminierung.
Aber bei Kinnunen sind ohnehin alle Einzelschicksale und Unterschiede im großen Ganzen der Familie aufgehoben. Blut ist dicker als Wasser, stärker als alle anderen sozialen Netzwerke. Freunde ziehen weg, Ehepartner trennen sich, Haustiere sterben, aber "Familie ist etwas, wovon man sich nicht trennen oder getrennt werden kann. Sie hält hartnäckig zusammen, kommt zu Besuch und hört zu." Nur mit ihr teilt man eine gemeinsame Geschichte und Sprache, und deshalb kehren früher oder später alle wieder in den Schoß der Familie zurück, wenn auch nicht immer freiwillig und unversehrt. Auch Tuomas geht wieder nach Lopotti zurück, heim ins Kaff der Deppen, schlechten Frauen und Rentierschlittenrennen, um seiner Tante Helena in ihrer letzten Stunde beizustehen. Als Kari sie verließ, war ihr Widerstandsgeist gebrochen; aus dem tapferen Mädchen wurde eine verbitterte alte Frau. Was sie am Ende sagt, könnte auch Tuomas unterschreiben: "Es geht im Leben nicht darum, glücklich zu sein." Wenn der Schein (und die beigegebene Stammtafel) nicht trügt, wird Tommi Kinnunen aus den Fotoalben und Dunkelkammern seiner Tanten, Geschwister und Enkel noch einige seiner lesenswerten Familiengeheimnisromane entwickeln.
MARTIN HALTER
Tommi Kinnunen: "Das Licht in deinen Augen".
Aus dem Finnischen von Gabriele Schrey-Vasara.
Penguin Verlag, München 2019, 367 S., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
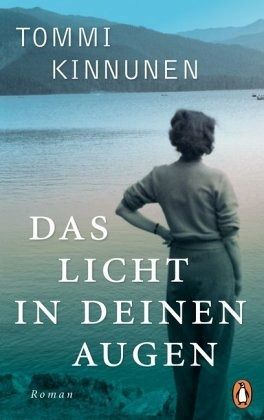




 buecher-magazin.deEs ist beinahe wie bei einem Familientreffen, bei dem man auf Menschen trifft, die man lange nicht mehr gesehen hat, die man liebgewonnen hat und mit denen man nun endlich einmal wieder Zeit verbringt und reden kann, um zu erfahren, wie es ihnen in der Zwischenzeit ergangen ist. Es ist zwar nicht erforderlich, erleichtert aber die Lektüre, wenn man Kinnunens ersten Band, „Wege, die sich kreuzen“, gelesen hat. In seinem neuen Roman widmet sich der finnische Autor nun Helena und Tuomas. Helena hat in ihrer frühen Kindheit ihr Augenlicht verloren und wird von ihren Eltern ins weit entfernte Helsinki auf eine Blindenschule geschickt. Sie soll eine selbstbewusste und vor allem selbstständige Frau werden. Der Weg dahin ist steinig und schwer. Aber auch der Weg von Tuomas, Helenas Neffe, ist alles andere als leicht passierbar. Als junger Mann versucht er, in einer Zeit, in der Homosexualität noch als eine abartige Krankheit gilt, seinen Platz in der Welt zu finden. Tommi Kinnunen versteht es abermals aufs Vorzüglichste, den Leser mitten ins Geschehen zu ziehen. Man weint und lacht mit den Protagonisten, fühlt sich mit ihnen verbunden und hofft inständig, dass sie ihren Platz im Leben finden werden.
buecher-magazin.deEs ist beinahe wie bei einem Familientreffen, bei dem man auf Menschen trifft, die man lange nicht mehr gesehen hat, die man liebgewonnen hat und mit denen man nun endlich einmal wieder Zeit verbringt und reden kann, um zu erfahren, wie es ihnen in der Zwischenzeit ergangen ist. Es ist zwar nicht erforderlich, erleichtert aber die Lektüre, wenn man Kinnunens ersten Band, „Wege, die sich kreuzen“, gelesen hat. In seinem neuen Roman widmet sich der finnische Autor nun Helena und Tuomas. Helena hat in ihrer frühen Kindheit ihr Augenlicht verloren und wird von ihren Eltern ins weit entfernte Helsinki auf eine Blindenschule geschickt. Sie soll eine selbstbewusste und vor allem selbstständige Frau werden. Der Weg dahin ist steinig und schwer. Aber auch der Weg von Tuomas, Helenas Neffe, ist alles andere als leicht passierbar. Als junger Mann versucht er, in einer Zeit, in der Homosexualität noch als eine abartige Krankheit gilt, seinen Platz in der Welt zu finden. Tommi Kinnunen versteht es abermals aufs Vorzüglichste, den Leser mitten ins Geschehen zu ziehen. Man weint und lacht mit den Protagonisten, fühlt sich mit ihnen verbunden und hofft inständig, dass sie ihren Platz im Leben finden werden. Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.11.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.11.2019