Woran liegt es, dass dieser Ton, dieser Rhythmus, diese Szenen und Figuren keines der Probleme aufwerfen, die sonst die Lektüre ambitionierterer Prosatexte fast immer beschweren? Nicht die nervigen Schönschreibdemonstrationen aus den amerikanischen Kreativschreibseminaren. Nicht die diskrete Langweiligkeit, die die Sensibilitätsbehauptungen vorwiegend deutscher Autoren meistens beglaubigen muss. Nicht die Mühe, die es dem Leser meistens macht, sich einigermaßen zurechtzufinden in den fiktionalen Kontexten, die ein Autor, auch mit viel Mühe, zusammengebastelt hat. "Das Leben des Vernon Subutex" spielt, bevor der Text zum Ende des zweiten Bandes hin auf Wanderschaft geht, in einem Paris, durch das man ganz real spazieren kann (oder fahren, mit Google Streetview). Und die Menschen, welche Virginie Despentes zum Sprechen bringt, ähneln vermutlich sehr den Menschen, welchen man dort begegnen könnte, in den Straßen des Pariser Nordostens oder im Parc des Buttes-Chaumont.
Die Antwort, die man sich selbst also vorläufig geben möchte, ist die, dass die Autorin womöglich gar kein Geheimnis hat. Sondern dass sie es einfach nur kann, sehr viel besser als viele andere; dass sie die Ökonomie des Schreibens und Beschreibens perfekt beherrscht, dass sie ganz besonders klar sieht, wovon man sprechen muss und worüber so ein Roman ruhig schweigen darf, wenn er nicht langweilig oder geschwätzig werden soll. Und dass sie sehr guten Rohstoff aus Erfahrungen, Erlebtem und Erlittenem zur Verfügung hat.
Virginie Despentes, das muss hier vielleicht wiederholt werden, war nicht immer die Autorin, auf die sich alle einigen konnten. "Baise moi", ihr erster Roman, und mehr noch ihre Verfilmung des eigenen Buchs, waren wegen ihrer Drastik und Explizitheit, starke Provokationen. Und bevor es losging mit dem Schreiben und dem Filmen, hat Virginie Despentes nicht nur in einem Plattenladen gearbeitet und in der Spätpunk- und Hausbesetzerszene gelebt; eine Zeitlang hat sie ihr Geld auch als Sexarbeiterin verdient.
Zu behaupten, dass es dieser Überschuss an Erfahrung sei, der sie zur besseren Schriftstellerin mache, wäre naiv und kunstfremd. Zu leugnen, dass Selbsterlebtes und Selbstgesehenes ihren literarischen Horizont erweitert haben, wäre es aber erst recht. Es war, ausgerechnet, Rainald Goetz, der ins Denken verliebte und von der Theorie begeisterte Autor, der vor ein paar Jahren, in seiner Heiner-Müller-Poetik-Vorlesung, nach ein paar wunderbar komplizierten intellektuellen Operationen zu dem Schluss kam, dass es beim Schreiben von Literatur letztlich nur darum gehe: um Sprachgefühl und Menschenkenntnis.
Über beides scheint Virginie Despentes zu verfügen - und wenn man beim Lesen von Virginie Despentes' Prosa manchmal ans Schreiben von Rainald Goetz denkt, glaubt man immer wieder, auch "Das Leben des Vernon Subutex" besser zu verstehen: Man hat ja, als an den Möglichkeiten zeitgemäßen Schreibens interessierter Leser, vor allem bei Rainald Goetz gelernt, was für ungeheure literarische Energien der Zorn, der Hass, das Ressentiment entfesseln können. Nicht weil es darum ginge, Gesinnungen in möglichst drastische Texte zu übersetzen. Sondern weil so ein Ressentiment verbindliche Verhältnisse schafft zwischen einem Ich und der Welt; weil es beiden eine Schärfe gibt, dem, der hasst, und dem Objekt dieses Hasses. Und weil so ein Ressentiment, wenn es sich sprachlich artikuliert, fast schon Sublimation ist und, wenn es zugleich seine Kraft nicht verlieren will, nach frischen Begriffen, unverbrauchten Wortschöpfungen, neuen Analogien suchen muss. Ressentiment als literarische Strategie kann große Kunst entstehen lassen - und bei Virginie Despentes wird, wie bei Goetz, daraus oft herrlichste Komik: wenn so ein kleiner Mensch von der Größe seiner Beschimpfungen überwältigt wird und am Schluss nur noch die schweren, bösen Wörter aufeinander und zurück auf den Sprecher krachen, weil der Adressat gar keine Rolle mehr spielt. "Kleiner weißer Bartträger, ganz sicher riecht dieser Scheißhaufen schlecht, wenn man näher rankommt, man sieht doch, dass er dreckig ist. Widerliche Fransen, ganz sicher stinkt das und hängt voller Essensreste, schon beim Anblick möchte man kotzen, eine Kugel in den Nacken, Dreckskerl, das wird dich lehren, dich morgens zu rasieren . . ."
"Das Leben des Vernon Subutex" ist auf drei Teile angelegt; der zweite ist soeben auf Deutsch erschienen - und deutlicher noch als im ersten Band offenbart sich hier, dass der Titel komplizierter gemeint ist, als man beim ersten Lesen denken möchte. Das Leben in Vernon Subutex wäre womöglich eindeutiger - denn dieser Subutex ist weniger der handelnde Held der Geschichte; er steht (und bewegt sich allenfalls sehr langsam) im Zentrum der Geschichte. Während die Action (eine Kategorie, die Despentes' Prosa schon angemessen ist) von denen kommt, die sich, auf welche Art auch immer, auf ihn beziehen. Der erste Band erzählte, wie Subutex erst seinen Plattenladen, dann seine Wohnung verlor - und wie er über die Betten seiner Freundinnen und die Schlafsofas seiner Freunde und Bekannten abwärtssurfte, bis er, obdachlos und zum Clochard geworden, im Parc des Buttes-Chaumont einen Unterschlupf fand. Der zweite Band erzählt, wie Freunde und Freundinnen, Kameraden und Gefährten sich auf die Suche machen nach Subutex, schon weil sie glauben, er besitze etwas, das sie alle haben wollen. Und wie Subutex, als er endlich gefunden wird, sich nicht retten lassen und zurückkehren will in eine bürgerliche Lebensform; wie er stattdessen den Park zu seinem Salon macht, in dem sich, wie einst, in den "Verlorenen Illusionen", bei der Marquise d'Éspard im Faubourg Saint-Germain, die Besucher einfinden, um mit Subutex oder auch nur miteinander zu sprechen. Und manchmal, gegen Abend, zieht dann die ganze Mannschaft ins "Rosa Bonheur", ein Café am Rand des Parks, wo sich offenbart, dass Subutex, der nicht viel spricht und schon gar nichts Bedeutendes zu sagen hat, wenn er aber Musik auflegt, ein DJ mit einem fast magischen Gefühl für den Herzschlag der Tanzenden wird.
All das, die vielen Figuren, die genaue Beschreibung der Lebensumstände und Schauplätze, hat viele professionelle Leser dazu verführt, beim Urteil über Virginie Despentes erst mal Maß zu nehmen bei Balzacs "Menschlicher Komödie". Der Fehler dabei wäre es, Virginie Despentes zu unterstellen, sie hätte, wie Balzac vor fast 200 Jahren, ihre Stadt, ihre Gesellschaft, ja die menschliche Bedingung ihrer Zeit in Prosa zu fassen versucht. Ihr Projekt ist bescheidener und, vielleicht, präziser; ihre Gestalten sind meistens über vierzig, unter sechzig, groß geworden mit einer Musik, die ihnen schon deshalb so wichtig war, weil die Glücksversprechen darin so stark und unwiderlegbar waren. Manche dieser Gestalten sind bitter, fast ein bisschen böse geworden, weil es, mit jedem Jahr, ein wenig dringlicher wird, das Glück endlich einzufordern. Und den Sex, das Abenteuer, die Selbstverwirklichung. Wer in Virginie Despentes auch Houellebecqs jüngere literarische Schwester sieht, hat einerseits recht, weil sie über ähnliche Kräfte verfügt. Aber die Hoffnung, dass der Mensch seiner eigenen Freiheit gewachsen sein könnte, die hat sie, anders als Houellebecq, noch längst nicht aufgegeben.
Was Virginie Despentes von Balzac gelernt haben könnte: Das ist die Erkenntnis, dass man weder Psychologe noch Reporter sein muss, um ein plastisches und tiefenscharfes Bild der Menschen in ihrer Gesellschaft zu zeichnen. Man muss den Menschen nicht tief in die Seele schauen; es reicht, dabei zuzusehen, wie sie handeln, und darauf zu achten, was sie treibt. Bei Balzac war das der Wille zum Aufstieg, die Gier nach einem Vermögen und dem gesellschaftlichen Status. Bei Despentes ist es fast schon das Gegenteil: Es scheint ihren Menschen nur darum zu gehen, das Glück und den Größenwahn ihrer Jugend bloß nicht dem Alter, dem Aufstieg, der Bürgerlichkeit zu opfern. Karrieren kommen kaum vor, Vermögen sind dazu da, die Partys zu bezahlen. Rührend ist die Episode von Charlie, der lebensklug und ein wenig versoffen ist. Und der, als er zwei Millionen im Lotto gewinnt, keine Ahnung hat, was er tun soll mit dem Geld.
Dass Virginie Despentes all diese Menschen wirklich kennengelernt, dass sie das Leben ihrer Generation (sie ist Jahrgang 1969) also recherchiert und studiert hätte; und dass es das sei, was ihre Prosa so belebt und beseelt: Das wäre wohl ein Missverständnis. Sie beobachtet das Handeln, sie identifiziert dessen Triebkräfte - und zu glauben, die empirische Wirklichkeit im Paris der zehner Jahre sei die einzige Quelle, aus welcher diese Prosa sich speist, hieße ohnehin, die Autorin weit zu unterschätzen. Es gibt eine Figur, die nur "die Hyäne" heißt und die immer wieder die Fäden der Figuren zieht. Es gibt eine Pornodarstellerin mit dem sprechenden Namen Pamela Kant, die, wenn sie auftaucht im Park oder einem Café, den erotisch ausgehungerten Männern wie ein Engel der Erotik erscheint, eine Abgesandte aus den eigenen Träumen. Es gibt einen Filmproduzenten, der von einer feministischen Guerrillatruppe überfallen, gefesselt und, zur Strafe für alles, was er Frauen angetan hat, zwangstätowiert wird - er bekommt die Anklageschrift auf den Rücken gestochen. Virginie Despentes hat selber davon berichtet, wie sie, als sie den Text verfasste, Fernsehserien geschaut und sich von deren Erzählweise hat inspirieren lassen. Wobei das serielle Erzählen eine französische Erfindung ist: Schon zu Stummfilmzeiten erzählten Louis Feuillades Serien "Fantômas" und "Judex" davon, wie das Irrationale einbricht in die strenge französische Bürgerlichkeit. Und wie dankbar der Bürger ist, wenn die Ordnung wankt und wackelt.
Man kann, nach zwei Bänden der Vernon-Subutex-Trilogie, wohl nur einen Zwischenbericht liefern, ein vorläufiges Ergebnis, eine Hypothese, welcher vom dritten Band womöglich widersprochen wird. Aber so lustvoll, wie sie immer wieder das Ressentiment zum Sprechen bringt; so explizit, wie sie, vor allem, die Frauen davon erzählen lässt, was deren sexuelle Gelüste sind und wer sie wie befriedigen kann; so aufwendig, wie sie all die Stimmen, die da zu Wort kommen, orchestriert und arrangiert, kann es gar nicht sein, dass ihr Projekt nur das Porträt einer Generation in ihrer Zeit sein will. Nein, dieser Text, der das Jenseits des Schönen immer wieder in der Musik vermutet, will selber wie ein großes, kraftvolles Stück Musik sein, ein Song, der leistet, was immer der Auftrag dieser Musik ist: den Mangel, das Leiden nicht nur zu beklagen. Sondern diesen Mangel zugleich aufzuheben für die Zeit, die er dauert.
CLAUDIUS SEIDL.
Virginie Despentes: "Das Leben des Vernon Subutex 2". Aus dem Französischen von Claudia Steinitz. Kiepenheuer & Witsch, 396 Seiten, 22 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
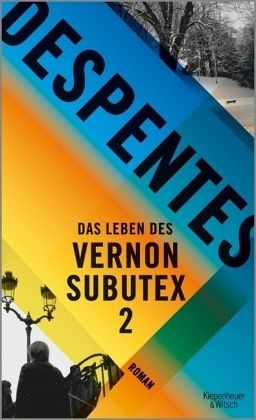



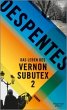

 buecher-magazin.deWiederbegegnung mit Vernon Subutex, der sich nach dem Verlust seines Plattenladens auf ein Dasein als Obdachloser im Park von Buttes Chaumont einrichtet - seine Identität "war ihm von den Schultern gerutscht wie ein alter, lästiger Mantel". Doch seine Freunde machen sich auf die Suche. Despentes beschreibt in ihrer präzisen, ironiegetränkten Sprache, wie sie alle in den Clochard Vernon einen Lebenssinn hineininterpretieren, der den Verwüstungen der modernen Großstadt eine Oase voller Musik entgegensetzt. Der angeschlagene Mann wird zum Rattenfänger der entspannten Art, dem alle in eine Gegenwelt zu folgen bereit sind. Oder ist das nur ein Wunschtraum, wie das Geheimnis des toten Rockstars Alex Bleach, dessen letztes Videoband Aufklärung über einen anderen Todesfall verspricht? Despentes ist eine viel zu gewitzte und tiefgründige Kritikerin der französischen Gesellschaft, als dass sie ihr Personal mit einfachen Lösungen davonkommen ließe. Die verschiedenen Versionen der Geschichte verbinden sich zu einem Kaleidoskop der Eitelkeiten, von Auf- und Absteigern, Süchtigen und Besserwissern, und der Name Subutex macht Sinn, denn so heißt ein Ersatzstoff für Heroin.
buecher-magazin.deWiederbegegnung mit Vernon Subutex, der sich nach dem Verlust seines Plattenladens auf ein Dasein als Obdachloser im Park von Buttes Chaumont einrichtet - seine Identität "war ihm von den Schultern gerutscht wie ein alter, lästiger Mantel". Doch seine Freunde machen sich auf die Suche. Despentes beschreibt in ihrer präzisen, ironiegetränkten Sprache, wie sie alle in den Clochard Vernon einen Lebenssinn hineininterpretieren, der den Verwüstungen der modernen Großstadt eine Oase voller Musik entgegensetzt. Der angeschlagene Mann wird zum Rattenfänger der entspannten Art, dem alle in eine Gegenwelt zu folgen bereit sind. Oder ist das nur ein Wunschtraum, wie das Geheimnis des toten Rockstars Alex Bleach, dessen letztes Videoband Aufklärung über einen anderen Todesfall verspricht? Despentes ist eine viel zu gewitzte und tiefgründige Kritikerin der französischen Gesellschaft, als dass sie ihr Personal mit einfachen Lösungen davonkommen ließe. Die verschiedenen Versionen der Geschichte verbinden sich zu einem Kaleidoskop der Eitelkeiten, von Auf- und Absteigern, Süchtigen und Besserwissern, und der Name Subutex macht Sinn, denn so heißt ein Ersatzstoff für Heroin. Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.03.2018
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.03.2018