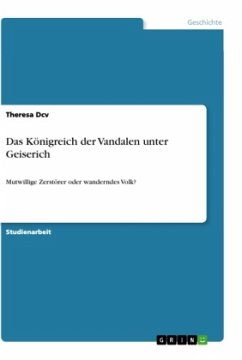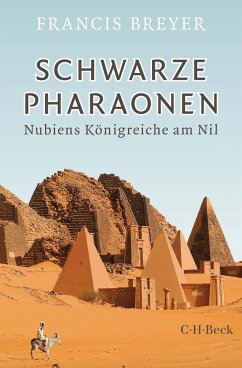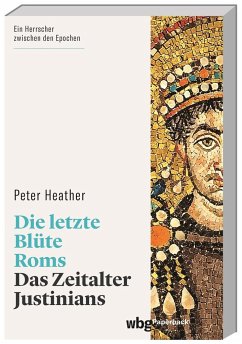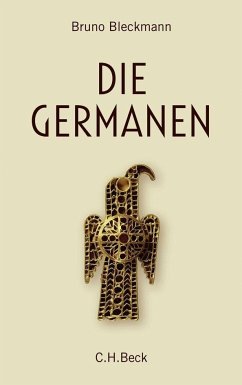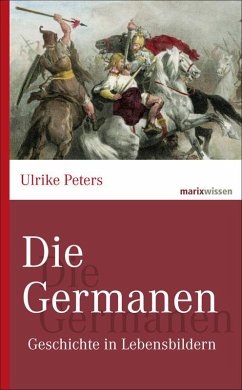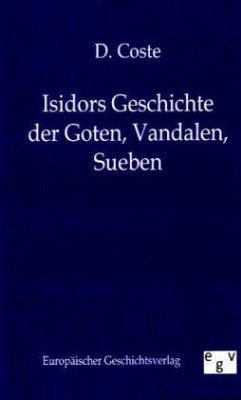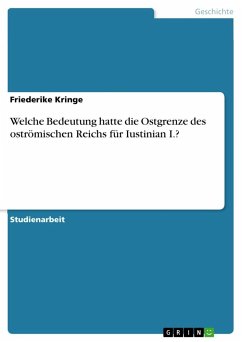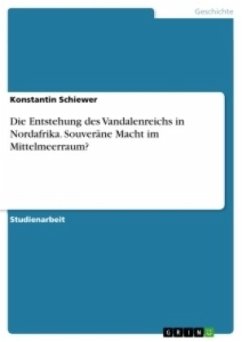Christus von Südspanien aus nach Afrika übersetzten, um die dortigen römischen Provinzen zu erobern, dachten sie gar nicht daran, das Kulturerbe der Antike zu vandalisieren. Im Gegenteil, sie setzten sich in die Villen, Thermen und Stadtpaläste der geflohenen Großgrundbesitzer und ließen es sich dort gutgehen. Die romanisierte Landbevölkerung durfte unter ihren neuen Herren fleißig weiterarbeiten, die Mühlen mahlten, die Olivenpressen knarrten, der Wein floss in die Fässer, und das reichlich wachsende Getreide, das bislang gratis beim weströmischen Kaiser in Rom und Ravenna abgeliefert worden war, wurde nun gegen harte Währung dorthin exportiert.
Der Reichsprovinz Africa (die das heutige Tunesien sowie Teile Algeriens und Libyens umfasste) ging es, wie archäologische Befunde zeigen, selten besser als unter der frühen Vandalenherrschaft - nur dass sie eben keine Reichsprovinz mehr war, sondern ein selbständiges politisches Gebilde, das dem wankenden Westreich allmählich das Wasser abgrub, symbolisch durch sein bloßes Dasein und real in Gestalt von Schiffen, mit denen vandalische Krieger alsbald Sizilien, Sardinien und Korsika eroberten und im Jahr 455 sogar Rom besetzten und gründlich plünderten.
Zwei Dinge allerdings machten die Vandalen ganz anders als andere, auf Dauer erfolgreichere Eroberer der Völkerwanderungszeit wie etwa die Franken in Gallien und die Westgoten in Spanien: Sie zerstörten die Mauern der Römerstädte, um dort keine Widerstandsnester gegen ihr Regime entstehen zu lassen; und sie blieben hartnäckig bei ihrem arianischen Glauben und entfremdeten sich damit ihren katholischen Untertanen, die an die Trinität und die Göttlichkeit Christi glaubten.
Beides gereichte dem germanischen Kriegervolk, das eine Variante des Gotischen sprach, zum Verderben, wie der Bonner Historiker Konrad Vössing in seiner Studie zum vandalischen Königreich in Nordafrika zeigt. Denn als gut hundert Jahre nach der Eroberung ein vom oströmischen Kaiser Justinian geschicktes Heer unter Belisar an der tunesischen Ostküste landete und auf Karthago vorrückte, unterstützte die Provinzbevölkerung ihre Glaubensgenossen aus Byzanz, und nach zwei verlorenen Schlachten und der kampflosen Räumung ihrer Hauptstadt blieb den Vandalen nur noch eine abgelegene Bergfeste, in der sie schließlich ausgehungert wurden. Ihr letzter König Gelimer freilich starb keineswegs, wie bei den klassischen Römern üblich, den schmählichen Hinrichtungstod des Besiegten, sondern durfte seinen Ruhestand auf einem geräumigen Landgut in Kleinasien verbringen - auch hier kein Vandalismus, nirgends.
Wenn man Vössings Buch richtig einschätzen will, muss man bedenken, dass es bei uns, abgesehen von dem Katalog zur Karlsruher Ausstellung von 2009, im Grunde kein Standardwerk über die Vandalen gibt. Vössings Studie hätte dieses Standardwerk sein können; nur leider ist sie mit ihren gut zweihundert Seiten (davon fünfzig Seiten Anhang) dann doch nicht umfassend genug. Es fehlt ein wie immer auch fragmentarisches Porträt von Geiserich, der das Vandalenreich nicht nur begründete, sondern auch in zwei großen Schlachten gegen west- und oströmische Flotten durchsetzte und sich dessen Existenz zweimal vertraglich bestätigen ließ. Und es fehlt eine zuspitzende Darstellung des Scheiterns seiner Nachfolger, die im Konflikt zwischen Beschwichtigungspolitik gegenüber ihren romanisch-katholischen Untertanen und Klientelismus gegenüber ihren Stammesbrüdern zerrieben wurden. Und schließlich hätte man sich auch eine knappe Analyse der erstaunlichen militärischen Erfolge der Vandalen gewünscht - denn es kann ja kein Zufall sein, dass es neben den Hunnen ein zweites Reitervolk war, das die spätantike Ordnung der Mittelmeerwelt zum Einsturz brachte. Gegen wandernde Stämme mit Ochsenkarren war das römische Verteidigungssystem aus fest stationierten limitanei (Grenztruppen) und mobilen comitatenses (Eliteeinheiten) effektiv, gegen zehntausend Kämpfer zu Pferde blieb es machtlos.
Der wahre Vandalismus, das lernt man bei Vössing immerhin, ist kein Zerstörungsrausch, sondern eine aggressive Variante von Immobilien-Shopping: Man kommt, siegt und verteilt die Beute unter sich. Am Ende, so mutmaßten schon antike Chronisten, wurde den Vandalen ihre Lust am guten Leben zum Verhängnis. Sie merkten einfach zu spät, dass die Party vorbei war.
ANDREAS KILB
Konrad Vössing: "Das
Königreich der Vandalen". Verlag Philipp von Zabern, Darmstadt 2014. 208 S., Abb., 24, 95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.09.2014
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.09.2014