Friedens zu werden. Die letzte Dekade unseres Säkulums hätte dann als vielversprechender Auftakt zu gelten. Es gibt seit 1990 keinen internationalen Krieg mehr auf der Welt. Zwar gibt es noch die Gewalt, aber sie hat sich in die Staaten zurückgezogen, ist zum Bürgerkrieg geworden.
Darin drückt sich ein beachtlicher Qualitätsunterschied aus. Der traditionelle Krieg überkam die Menschen wie ein apokalyptischer Reiter, unerklärbar, unentwegt. Er gehörte zum internationalen System wie die Souveränität zum Staat. Der Bürgerkrieg hingegen hat klar geschnittene Ursachen und, wenn sie beseitigt worden sind, ein Ende. Kann man die Bürgerkriege der Gegenwart schon als ein Postskriptum des Krieges ansehen?
Die Frage durchweht keineswegs ein chiliastischer Hauch. Sie spitzt nur die wichtigste These zu, die Gabriel Kolko in seinem Buch ausgebreitet hat. Keiner der Kriege des 20. Jahrhunderts war erfolgreich. Jeder hat, im Endeffekt, nur den Gegner begünstigt. Sie waren zwar internationale Kriege, hatten aber ihre Ursachen und größten Wirkungen in der Innenpolitik der teilnehmenden Staaten. Die Kriege bildeten das Grundferment der sozialen Revolution, waren die Geburtshelfer der Linken.
Kolko hat dieser These seine beiden Hauptkapitel gewidmet. Im Ersten Weltkrieg gingen das zaristische Russland wie das monarchische Deutschland zugrunde, kam im republikanischen Frankreich die Volksfront an die Macht. Die dann im dialektischen Gegenzug erstarkende Rechte brach den Zweiten Weltkrieg vom Zaun. Er stürzte Europa erneut ins Chaos, zerrüttete seine gesellschaftlichen Ordnungen. Der entsprechend große, eigentlich zu erwartende Linksrutsch blieb 1945 aus, weil sich die Sowjetunion unter Stalin zur Status-quo-Macht entwickelte und die kommunistischen Parteien Europas am kurzen Zügel hielt. In China überließ eine korrupte Kuomintang das Feld freiwillig den Kommunisten, die sich dann aber dem pragmatisch handelnden Mao unterordneten. Weil die globalen Ausmaße des Zweiten Weltkrieges - schreibt Kolko - den gesellschaftlichen Wandel nicht konzentrierten, sondern internationalisierten, milderten sich seine politischen Auswirkungen. So kam die Linke in Griechenland, in Italien und Frankreich um den Sieg, der eigentlich zum Greifen nahe gewesen war.
Kolko beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Furchen, die die beiden Weltkriege hinterließen, und erkennt in ihnen ein wiederkehrendes Muster. Die wilhelminischen Eliten fürchteten die Linke mehr als die Niederlage im Krieg gegen den auswärtigen Gegner. Hitler konnte sich nur mit dem permanenten Ausnahmezustand und schließlich mit dem Krieg an der Macht halten. Die beiden Weltkriege, argumentiert Kolko, hatten ihre tiefsten Wurzeln im Herrschaftssystem, ihre wichtigsten Folgen in den gesellschaftlichen Ordnungen.
Diese These kontrapunktiert die gängige Geschichtsschreibung, die diese Zusammenhänge auch kennt, ihnen aber die große Politik überordnet. Für sie ist der Kampf der Mächte und der Zusammenprall der nationalen Interessen entscheidend. Kolko aber zeigt den Krieg von innen, präsentiert ihn als Produkt innenpolitischer und herrschaftspolitischer Spannungen.
Leider hat er diesen richtigen Ansatz nicht auch auf die Linke erstreckt, die nach 1945 in Osteuropa und in der Sowjetunion, nach 1949 in China herrschte. Es stimmt zwar, dass Stalin international eine Status-quo-Politik betrieb, Mao sich nach außen pragmatisch verhielt. Aber darüber darf nicht vergessen werden, was der eine in Osteuropa, der andere in China mit Gewalt angerichtet hat. Beide benutzten den Konflikt mit dem Westen, um ihre Herrschaft im Innern zu stabilisieren. Das bestätigt Kolkos These umso eindrucksvoller, als nach dem Ende des Ost-West-Konflikts der Kommunismus im Ostblock zusammenbrach und in China stillschweigend vom Tisch genommen wurde. Aber Kolko geht diesen Konsequenzen nicht nach. Als Revisionist bürstet er die Geschichte gegen den Strich, aber eben nur in einer Richtung. Das ist schade. Denn die große Gewaltursache, die Kolko im autoritären und diktatorialen Herrschaftssystem entdeckt hat, müsste gerade auch in der aktuellen außenpolitischen Debatte bedacht werden.
Kolko hat den beiden, eher narrativ gehaltenen Hauptkapiteln, die sich mit den Weltkriegen beschäftigen, ein Kapitel vorangestellt, das sich den Kriegsursachen systematisch zu nähern versucht. Er bereitet hier sozusagen das theoretische Instrumentarium auf, mit dem er die geschichtlichen Furchen pflügt. Zur Hypothese von der angefochtenen Herrschaft als Kriegsursache gesellt sich der Hinweis auf die mehr idiosynkratischen Antriebe. Kolko erkennt sie in der kognitiven Ausstattung der politischen und militärischen Entscheidungsträger, den Einflüssen, die aus ihrer Herkunft, ihrer Bildung und ihrer Sozialisation stammen. Beziehungen zu Hof und Regierung waren für die Karriere der maßgebenden Entscheidungsträger wichtiger als ihre Ausbildung und ihre Kenntnisse. In polemischer Übertreibung kritisiert Kolko die "endemische Borniertheit der herrschenden Schichten" und den "Offiziersdünkel". Er arbeitet den Kriegerkult heraus, der auf allen Seiten der Weltkriegsteilnehmer gepflegt wurde. Der Held wurde zum Leitbild der Gesellschaften stilisiert, die soldatische Tugend verallgemeinert. Überall herrschte ein grenzenloses Vertrauen in die Ordnung stiftende Kompetenz militärischer Gewalt, obwohl deren strategische Konzepte spiegelbildlich austauschbar waren und deshalb erfolglos blieben. Kolko weist nach, wie es auf allen Seiten der Kriegführenden von Irrtümern, Fehlannahmen und Sorglosigkeiten geradezu wimmelte. So wurden aus den ursprünglich geplanten Blitzkriegen jahrelange Weltkriege. Krieg - bilanziert Kolko - musste damals und kann heute nur einem "System der Unvernunft" entspringen.
Kolkos Darstellung der Gewaltursachen ist nicht vollständig; das wird man einem Historiker nachsehen. Verdienstvoll ist, dass er sich überhaupt diesem Versuch unterzieht und dabei Einsichten zutage fördert, die den Gang der Geschichte sehr erhellen - und der aktuellen Diskussion über die Außenpolitik zugute kommen können. Umso reizvoller wäre es gewesen, wenn Kolko sein letztes Kapitel, das auf fünfzig Seiten die fünfzig Jahre nach 1945 zusammenrafft, auch seiner Hauptthese gewidmet hätte. Beginn, Verlauf und Ende des Ost-West-Konflikts hätten ein ergiebiges Testfeld für sie abgegeben. Stattdessen hat Kolko die Zeit nach 1945 anhand der amerikanischen Außenpolitik abgeschildert. Das Thema gehört zu seinem Standardrepertoire. Er führt es hier anhand der amerikanischen Militärdoktrin aus und findet dort viel Bestätigung für seine Kritik. Er sieht in den Vereinigten Staaten den Exponenten der neuen Konservativen, die sich weltweit gegen die Linke wenden und deswegen die traditionalen alten Eliten in allen Ländern, vor allem in Asien, unterstützt haben.
Diese These ist nicht neu, gewinnt aber durch die Einordnung in die von Kolko zuvor aufgeblätterten Zusammenhänge Überzeugungskraft. Kolko, der 1994 den Luftkrieg gegen Serbien und die Bombardierungen des Irak nicht vorhersehen konnte, hat damals seiner These entsprechend solche Ereignisse vorhergesagt. Das bestätigt die These noch nicht, lässt es aber angelegen erscheinen, sich näher mit ihr zu befassen.
ERNST-OTTO CZEMPIEL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
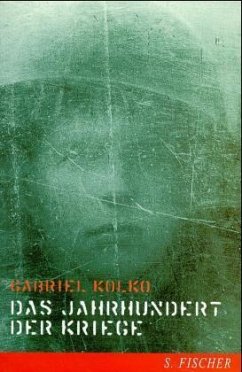




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.11.1999
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.11.1999