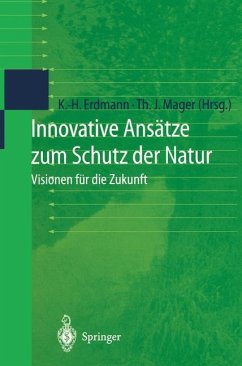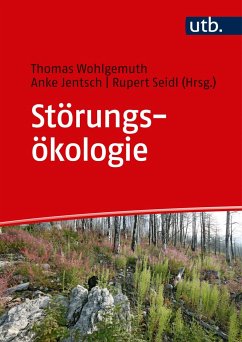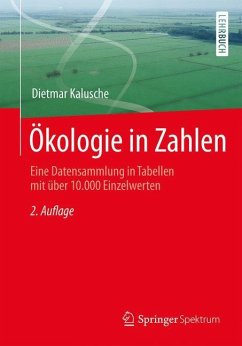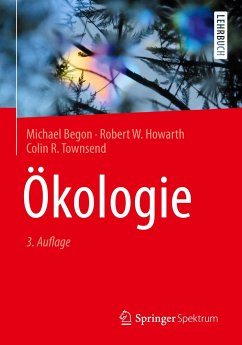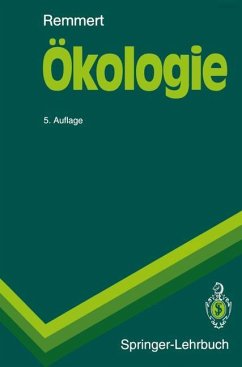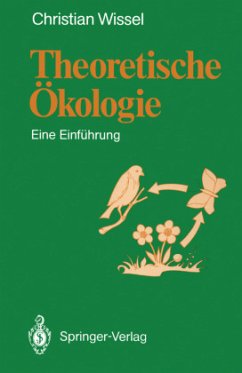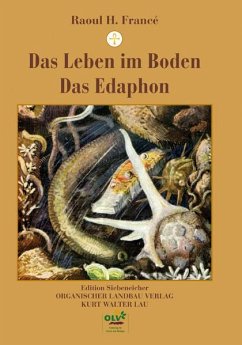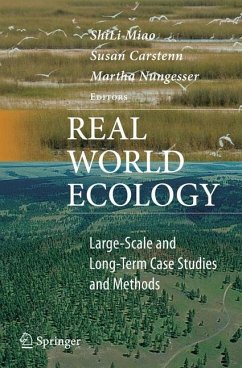Lehre vom Wandel in der Natur. Zwar sehnt sich der Mensch verständlicherweise nach einer beständigen Umwelt und vor allem einer beständigen Nahrungsmittelversorgung, doch für die wissenschaftliche Ökologie ist das Streben nach Stabilität eine fachfremde Vorgabe. Dies bedeutet nicht, so der Autor, daß man sich bei der Nutzung der natürlichen Ressourcen nicht um Nachhaltigkeit bemühen sollte, Nachhaltigkeit verstanden im Sinne der Brundtland-Kommission als Entwicklung, die die "Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können". Doch dies, meint Küster, sei stets mehr oder weniger erfolgreich das Ziel der menschlichen Bestrebungen gewesen, der Jagd ebenso wie der Landwirtschaft und der industriellen Produktion.
In der Ökologie dagegen geht es um die komplexen Beziehungen zwischen den Lebewesen untereinander und zu ihrer Umwelt, um Stoffwechselprozesse und Nahrungsketten, um Konkurrenz und Selektion. Dabei macht der Wandel, der die Natur bestimmt, auch dem Charakter der Ökologie als Wissenschaft zu schaffen: Die Individuen unterscheiden sich voneinander, Ökosysteme lassen sich nicht wirklich abgrenzen, sie haben keinen Normalzustand und keine "Schlüsselarten", die ablaufenden Prozesse sind irreversibel und hochkomplex, ob eine Art tatsächlich ausgestorben ist, läßt sich ebensowenig feststellen wie die Anzahl der Arten in einem Ökosystem. Naturgesetze wie in der Physik sucht der Ökologe vergeblich.
Doch wer handeln will, muß sich auf konkrete Daten stützen können, ein "Alles fließt" ist da wenig hilfreich. Um solche zu liefern, bedienen sich viele Forscher mathematischer Modelle und Simulationen von Entwicklungsprozessen. Diese beruhen naturgemäß auf einer vereinfachten Datenbasis, ihre Ergebnisse zeigen mögliche, keine notwendigen Entwicklungen. Küster sieht die Verwendung solcher Modelle in der Ökologie allerdings sehr kritisch. Die Ökologie hat ihre Basis in der Biologie, schreibt er, nicht in einem Rechenprozeß, der die Lebewesen "schon längst geklont hat, bevor dies in der Realität geschehen ist". Was zur Handlungsorientierung an ihre Stelle treten soll, bleibt bis auf den etwas vagen Hinweis, daß alle ihre Erfahrungen einfließen lassen sollen, offen.
So wie die Ökologie keine präzisen Voraussagen liefert, liefert sie auch keine Handlungsanweisungen für den Naturschutz. Naturschutz als Bewahrung, so Küster, steht der Ökologie sogar entgegen. Naturschutz kann allenfalls bedeuten, die Natur einfach in Ruhe zu lassen, mit dem Ergebnis natürlich, daß die Ökosysteme nicht bleiben, wie sie sind, daß Lichtungen und Heidelandschaften zuwachsen, Seen verlanden. Überhaupt hat der Autor für die gängige Praxis des Naturschutzes nichts übrig. Planwirtschaft sei das, wettert er mit Blick auf Kyoto-Protokoll und europäische Umweltschutzrichtlinien - und auch der Hinweis darauf, daß es die Nazis waren, die das erste Naturschutzgesetz erließen, fehlt in seiner Polemik nicht.
Ein weiteres Mißverständnis sieht Küster in der Gegenüberstellung von Natur und Industrie. Umweltprobleme, betont er völlig zu Recht, wurden schon im alten Rom beklagt. Die These, daß mit der Industrialisierung nicht die Probleme, sondern die Lösungsmöglichkeiten kamen, vereinfacht die Sache dann aber wohl doch etwas zu sehr, vor allem wenn unter diesen Lösungsmöglichkeiten die Atomenergie auftaucht.
Aus dem Sein folgt bekanntlich kein Sollen und aus der Ökologie nicht, daß man das eine Ökosystem auf Kosten des anderen, ja nicht einmal, daß man überhaupt eins erhalten sollte. Doch dafür kann es natürlich andere Gründe geben, kulturelle oder ästhetische etwa. Konsequenterweise fordert Küster, den Naturschutz aufzugeben und durch einen basisdemokratisch organisierten Landschaftsschutz zu ersetzen, bei dem die Bevölkerung mitentscheiden kann, in welcher Landschaft sie leben möchte.
Küster hat kein trockenes Lehrbuch geschrieben, sondern vor allem einen Traktat darüber, was Ökologie kann und was nicht. Zwischendrin erfährt der Leser allerlei Interessantes, etwa darüber, wie das Wiederkäuen funktioniert, was Pilze eigentlich sind, daß Menschen Meister darin sind, "Distreß" in "Eustreß" zu verwandeln, also mit Krisen fertig zu werden, und daß die Errichtung von Zäunen die Vorbedingung für die Einführung der allgemeinen Schulpflicht war - die Kinder mußten nicht mehr den ganzen Tag Tiere hüten. Am Ende bleibt der Leser leicht verwirrt mit dem Bild einer Disziplin zurück, die dem Autor zufolge zwar dringend gebraucht wird, deren Ergebnisse aber aufgrund des allgegenwärtigen Wandels nur mit großer Vorsicht zu genießen sind.
MANUELA LENZEN.
Hansjörg Küster: "Das ist Ökologie". Die biologischen Grundlagen unserer Existenz. C. H. Beck Verlag, München 2005. 208 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
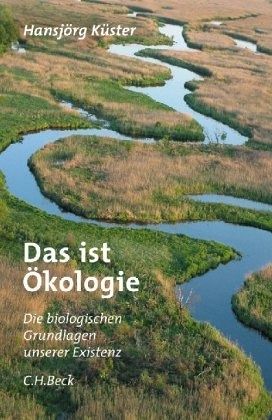




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.09.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.09.2005