Institut Français zum nächsten, pendelnd zwischen Paris und Port-au-Prince, Dakar und Montreal, und sein in Frankreich lebender Vater macht tiefe Bücklinge vor dem Sohn, dessen Blitzkarriere ihm wie ein Wunder erscheint, was Wilfried N'Sondé nach eigenem Bekunden peinlich ist.
"Faut-il brûler la bibliothèque coloniale": Soll man die Kolonialbibliothek verbrennen, wurde er kürzlich in Haiti gefragt, und seine Antwort verblüffte durch pragmatischen Menschenverstand im Unterschied zum ideologischen Blabla selbsternannter Vordenker der Dritten Welt: Nein, denn Bücher seien viel zu wertvoll, um verbrannt zu werden - eine ökonomische Begründung, die Brecht gefallen hätte. Und seine Eindrücke von Afrika, das N'Sondé nach jahrzehntelangem Exil erstmals wieder sah, fasste er so zusammen: Das Hauptproblem sei der Müll, und statt über Neo- oder Postkolonialismus zu klagen, sollten die Afrikaner lieber ihren Müll wegräumen.
Wie viele Migrantenkinder stammt Wilfried N'Sondé nicht aus den Slums, sondern aus einer Familie von Schriftgelehrten: Sein Onkel schrieb eine Grammatik der Kikongo-Sprache, und sein Vater floh vor der Verfolgung und Unterdrückung eines prosowjetischen Militärregimes, das seine Menschenrechtsverletzungen mit linker Rhetorik tarnte: "Mit der Kalaschnikow bläuten sie ihm die marxistisch-leninistischen Grundsätze ein und nahmen anschließend eine eingehende, gründliche Untersuchung unter den Schürzen seiner Frau und seiner Töchter vor. Auch seine Söhne wurden in die eisernen Regeln der Revolution eingeweiht, halb totgeprügelt und mit ihm zusammen eingesperrt. Leg dich nicht mit der Armee an!"
Um Missverständnisse zu vermeiden: Hier ist nicht die Rede von Joseph Conrads "Herz der Finsternis", dem früheren Belgisch-Kongo, vom korrupten Diktator Mobutu umbenannt zu Zaire, sondern von der ehemals französischen Kolonie am Nordufer des Flusses. Schon das kurze Zitat zeigt die Kunst des Autors, mit wenigen Worten die Dinge beim Namen zu nennen, ohne didaktisch erhobenen Zeigefinger und ohne intellektuelles Imponiergehabe, das unter afrikanischen Schriftstellern nicht selten zum guten Ton gehört. Der schwarze Kontinent wird nicht idyllisch verklärt zum verlorenen Paradies, an dessen Zerstörung einzig und allein der Kolonialismus schuld sein soll - der Sündenfall hat tiefere Ursachen und setzt sich bis in die Gegenwart hinein fort: "Wir lernten erst zu bitten, dann zu fordern, und heute sind wir ein Volk von kläglichen Bettlern mit ständig ausgestreckter Hand. Und leerem Bauch. Die traurigen Augen himmelwärts gerichtet, weil das Heil in Form von Frachtflugzeugen voller Medikamente und Lebensmittel kommt."
Diesem illusionslosen Fazit wäre nichts hinzuzufügen, handelte das vorliegende Buch nur von Afrika und nicht auch von Europa, genauer gesagt von Frankreich, wo Wilfried N'Sondé seine Kindheit und Jugend verlebte und an der Sorbonne studierte, bevor es ihn nach Deutschland verschlug. Der Roman ist der innere Monolog eines jungen Schwarzen, der sich mit Handschellen geknebelt, bekifft und betrunken, getreten und geschlagen auf einer Pariser Polizeiwache wiederfindet, ohne zu begreifen, was ihn hierhergeführt hat. In einem Selbstgespräch von schonungsloser Radikalität und betörender Musikalität, dessen stakkatohafter Rhythmus an Rap-Songs erinnert, legt der Ich-Erzähler Rechenschaft ab über sein bisheriges Leben: vom Schatten eines Ahnen, der ihm Tröstliches, aber auch Verstörendes zuwispert, bis zum sadistischen Kommissar und der hübschen Polizistin, die das Erbrochene in seiner Zelle aufwischt: Nicht zu vergessen Mireille, seine aus einer jüdischen Familie stammende Geliebte, die ihn aus Ekel und Frust vor dem Leben in der Vorstadt verlässt, oder die Jugendfreunde Drissa und Kamel, von denen einer in den Wahnsinn, der andere in den Terrorismus abgleitet.
Schon das dürre Resümee macht deutlich, worauf der aktuelle Erfolg des Romans basiert: auf dem Missverständnis, es handle sich um eine literarische Aufarbeitung der Jugendrevolte in den Gettos französischer Vorstädte, die alle Jahre wieder für Schlagzeilen sorgen mit brennenden Müllcontainern, abgefackelten Autos, verletzten Polizisten und verprügelten oder toten Demonstranten. An diesem Missverständnis ist N'Sondé nicht unschuldig, obwohl sein Buch lange vor Ausbruch der Unruhen nicht in Paris, sondern in Berlin entstand und, rückblickend auf die eigene Kindheit und Jugend, den tristen Alltag französischer Schlafstädte schildert: "Als Kinder sind Drissa und ich immer in die Bäckerei des Viertels gegangen, die Verkäuferin hat uns angelächelt, wie süß sie sind mit ihren Löckchen, Streichelbäckchen, Krausköpfchen . . . Erst später, mit dreizehn, vierzehn, wurden wir Fremde, Verbrecher, ,Integration', ,Immigration', Illegale, Toleranzschwelle in politischen Pogrammen."
Dazu passt, was der Ich-Erzähler des Romans in schmerzhafter Selbstprüfung zutage fördert: dass er sich aus Liebeskummer betrunken und, ohne es zu wollen, einen Polizisten getötet hat - nicht den rassistischen Kommissar, der ihn auf dem Weg zur Wache malträtiert, sondern dessen Kollegen, einen Familienvater und vorbildlichen Beamten, der den Integrationsauftrag ernst nimmt und Konflikte gewaltfrei zu lösen versucht wie jener von deutschen Hooligans zum Krüppel geschlagene Flic, dessen Schicksal die Medien beider Länder bewegte. Aber nicht in seiner politischen Botschaft liegt die Stärke dieses von Brigitte Große kongenial übersetzten Romans, sondern in der Stilsicherheit des Autors, der komplexe Sachverhalte einfach darzustellen und, unbekümmert um literarische Konventionen, mitreißend zu erzählen versteht.
HANS-CHRISTOPH BUCH.
Wilfried N'Sondé: "Das Herz der Leopardenkinder". Roman. Aus dem Französischen übersetzt von Brigitte Große. Verlag Antje Kunstmann, München 2008. 128 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
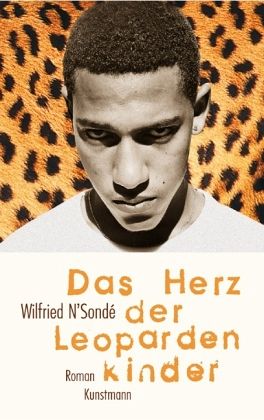




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.09.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.09.2008