inzwischen für die kecke These interessiert, Maria Magdalena sei nicht nur die Gattin Jesu gewesen, sondern auch die Mutter seiner Tochter. Der Templerorden, Leonardo da Vinci und die Geheimgesellschaften seien, so der blumig-esoterische Plot, Hüter des Geheimnisses der hierdurch begründeten und doch tatsächlich bis zur weiblichen Hauptfigur reichenden Dynastie gewesen.
Dan Brown schmückte nur aus, was zu guten Teilen der Hochstapler Pierre Plantard erdacht hat, der sich und seiner "Bruderschaft vom Berg Zion" in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit gefälschten Dokumenten eine bis zu den Merowingern zurückreichende Tradition zu verschaffen suchte. Behilflich war Plantard dabei ein talentierter Esoteriker namens Gérard de Sède. Er fügte der fiktiven Genealogie eine wichtige Zwischenstation hinzu, die Landpfarrei Rennes-le-Château bei Carcassonne, deren Pfarrer Bérenger Saunière Ende des 19. Jahrhunderts plötzlich zu erstaunlichem Reichtum gelangt war, was man nun mit dem mythischen Templerschatz erklärte.
Den Gipfel der Absurdität erreichte der Mythos mit den Journalisten Michael Baigent, Richard Leigh und Henry Lincoln, welche die Blutlinie 1982 in ihrem Bestseller "Der heilige Gral und seine Erben" bis zu Maria Magdalena zurückführten, wobei sie freizügig Verschwörungstheorien und eigensinnig interpretierte historische Quellen vermengten.
Die Geschichtswissenschaft hatte für diese Konstrukte nie mehr als ein Achselzucken übrig. Nun aber unternimmt es ein französischer Historiker in einem imposanten Buch, das selbst einem Thriller gleicht, die Mär zu dekonstruieren. Mit Alexandre Adler tritt allerdings weniger ein Annales-Historiker vor das Publikum als ein erfahrener Publizist. Das macht den besonderen Charakter des Buchs aus.
Adler präsentiert die obengenannte Variante der Erzählung in all ihrer Lächerlichkeit, zitiert auch die gängigen Erklärungen der "radikalen Skeptiker". Doch so leicht komme man dem Geheimnis um Rennes-le-Château nicht bei. Adler schätzt nämlich de Sède als "von Grund auf ehrlich" ein. Und warum fand Abbé Saunière so viel Protektion, nicht nur durch den Bischof von Carcassonne, sondern auch durch mehrere Päpste? Hat es also doch mit den sich im Süden Frankreichs niederlassenden Templern zu tun?
Nun knöpft sich Adler mit Verve noch einmal sämtliche Theorien vor. Vielem kann er durchaus etwas abgewinnen, der Ansicht etwa, dass in Nicolas Poussins berühmtem Hirtengemälde "Et in Arcadia ego" eine Landschaft bei Rennes-le-Château dargestellt ist oder dass es die erste Jüngerin ins französische Exil trieb. Klarer aber sind die Absagen, die der Historiker erteilt: Weder Leonardo da Vinci habe mit der Sache etwas zu tun, noch gebe es auch nur entfernte Hinweise auf eine Nachkommenschaft Jesu.
Was so entsteht, ist ein zahlreiche Orden und Geheimgesellschaften umspannendes Möglichkeitspanorama mit vielen Leerstellen, aber einer insgesamt hohen Wahrscheinlichkeit. Weil Adler es für seine Argumentation braucht, konstatiert er auch einmal flugs die uneheliche Herkunft des Sonnenkönigs, weicht damit freilich vom Stand der Forschung gehörig ab. Über verschiedene rekonstruierte Verbindungslinien stehen die Katharer, der späte Templerorden und noch die Freimaurer mit der von ihm nachgezeichneten Tradition in Verbindung.
Gibt es nun einen Schatz in Rennes-le-Château, und von wo stammt er? Die spekulativste Denkmöglichkeit ist es, dass es sich um den alten, über die Westgoten nach Gallien gelangten Tempelschatz von Jerusalem handeln könnte. Selbst damit aber wäre jedem Mysterium der Boden entzogen. Immer noch wahrscheinlicher wäre es ohnehin, dass die Templer hier Wertvolles hinterlegt haben, aber wohl kaum die gefundene Bundeslade, sondern möglicherweise den ihnen anvertrauten Schatz der Katharer. Wie das zudem mit einem mittelalterlichen Judenkönigreich in Narbonne zusammenhängt, mag man - es soll nicht alles verraten werden - in dem rasant durch die Geschichte eilenden Buch selbst nachlesen.
Von einer gewissen mythischen Überhöhung des Templerordens aber ist auch Adler nicht frei. Es mögen sich ja die späten Templer, wie Adler meint, mystischen Elementen muslimischer Herkunft geöffnet haben. Doch zur Generalerklärung für ein intellektualisiertes Rittertum im hohen Mittelalter und die gesamte Artusepik taugt das wohl nicht. Besonders problematisch ist, dass sich Adler an dieser Stelle auf Inquisitionsdokumente stützt und damit womöglich der Propaganda des französischen Königshauses unter Philipp IV. ins Netz geht, die eine solche Untat wie die Verbrennung des Großmeisters eines bedeutenden und aufopferungsvollen Ordens durch ungeheuerliche Vorwürfe zu legitimieren hatte. Zerrieben wurden die Templer schlicht im Machtkampf zwischen dem französischen König und dem Papst. Der Spannung dieses Buches aber nimmt dies nichts.
OLIVER JUNGEN
Alexandre Adler: "Das Geheimnis der Templer". Von den Rosenkreuzern bis Rennes-le-Château. Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Verlag C. H. Beck, München 2009. 240 S., 1 Karte, geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
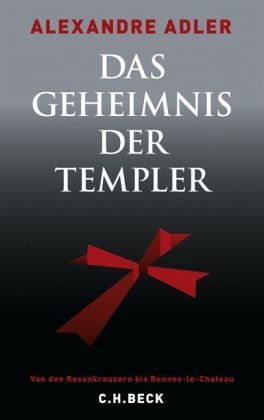



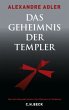

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.07.2009
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.07.2009