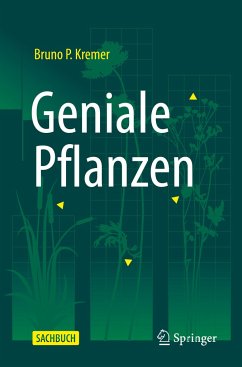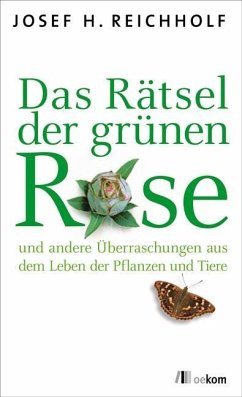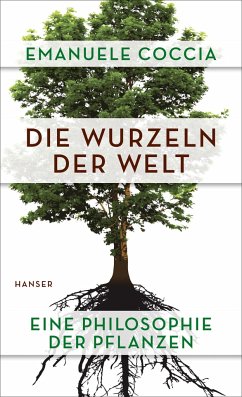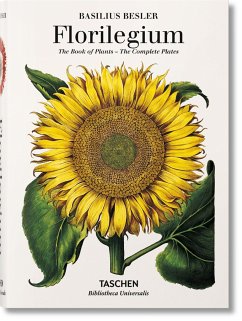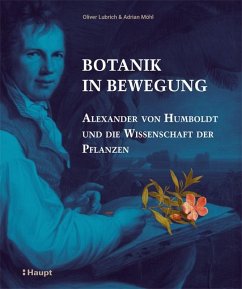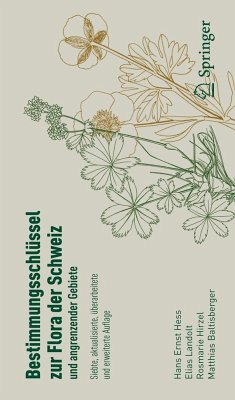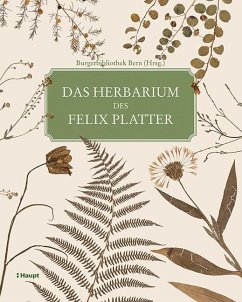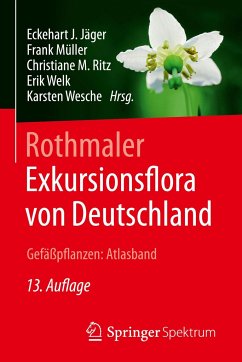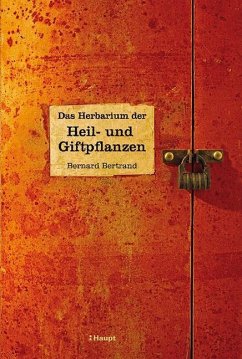Mittelpunkt des Buchs stehen Herbarien, diese riesigen Bibliotheken aus "Belegen" in Form gepresster Blätter, Stengel, Blüten, Früchte, die duften oder stinken und bisweilen aus ihren viel zu kleinen Kästen quellen, oft versehen mit langen handschriftlichen Beschreibungen. Kein Bild könne je das Geschriebene ersetzen, nur die Beschreibung sei in der Lage, "in das Geheimnis der Pflanze vorzudringen", so der Autor.
Doch die Herbarien sind, das sieht Jeanson mit einer gewissen Nostalgie, Überbleibsel aus einer Zeit, in der Überseehandel die ungeheure Vielfalt der Pflanzenwelt dem alten Europa erstmals vor Augen führte und in der die Gelehrten noch hofften, diese Vielfalt in eine Ordnung zwingen zu können. Oft vergeblich, denn obwohl sie wohlgeordnet erscheinen, sind zumindest die älteren unter diesen Herbarien Jeanson zufolge eher Dschungel, in denen sich nur zurechtfindet, wer den größten Teil seines Lebens darin verbracht hat.
Jeanson berichtet von den Forschungsreisenden, die diese Sammlungen zusammengetragen haben, meist im Gefolge von und manchmal in Personalunion mit Kolonialisten oder Missionaren. Er versteht es, ihre Faszination angesichts der tropischen Vegetation zu vermitteln - und zugleich die gesundheitlichen und politischen Gefahren, in die sie sich begaben. Wer als Botaniker alt werden wollte, schickte lieber andere auf die Suche nach unbekannten Pflanzen. Ein Drittel der "Gesandten", die der schwedische Botaniker und Begründer der noch heute gebräuchlichen Nomenklatur, Carl von Linné, auf die Reise geschickt hatte, kam "in der Urne heim". Der Gelehrte habe vor allem Junggesellen für diese Posten ausgewählt, um sich angesichts dieser Lage den "Groll der trauernden Witwen" zu ersparen.
Linné ordnete im achtzehnten Jahrhundert die Pflanzen neu, und zwar nach der Anzahl und Position ihrer Stempel und Staubblätter. Das war keine gelehrte Petitesse, sondern ein handfester Skandal: Als man feststellte, dass Pflanzen, ähnlich wie Tiere, unterschiedliche Geschlechter haben, dass Blüten gar Geschlechtsorgane seien, habe die liebliche Pflanzenwelt in den Augen der Zeitgenossen ihre Unschuld verloren. Blumensträuße, so Jeanson, trieben "den Jungfern" nun das Blut in die Wangen, in den Salons kicherte man über die Anzüglichkeiten der Botaniker. Und ausgerechnet dieses Unsagbare machte Linné zum Grundprinzip seiner Ordnung.
Spannend sind auch Jeansons Ausführungen darüber, wie das massenhafte Versenden von Proben die Gartenkultur Europas und die Weltpolitik veränderte. Die Repräsentanten von Alter und Neuer Welt wetteiferten, wessen Botanik am meisten zu bieten habe, und französischer Chicoréesamen konnte in den Vereinigten Staaten zum Symbol der Verbundenheit der Nationen werden. Ein anderer Nebeneffekt: Wer etwas über asiatische Palmen wissen will, ist heute in den Herbarien und Tropenhäusern New Yorks am besten aufgehoben.
Manches, von dem Jeanson berichtet, ist witzig, etwa die Probleme, die der Autor, Experte für Palmen, mit seinen etwas unhandlichen Forschungsgegenständen hat. Über die dressierten Affen, die an seiner Stelle emporklettern sollten, hätte man gerne mehr als nur eine Andeutung gelesen. Um die Forschungsreisen, die er in die verschiedensten Weltgegenden unternommen hat, beneidet man Jeanson, auch wenn er nicht versäumt, immer wieder auf die damit einhergehenden Strapazen hinzuweisen. Ein wenig amüsiert sich Jeanson auch über sich selbst, zumindest wirkt es, als könne er nicht glauben, den Leser davon überzeugt zu haben, wie spektakulär es war, festzustellen, dass eine seltene Palme viele Jahre einer falschen Art zugeordnet worden war.
Der Autor bedauert, dass die alle Sinne ansprechenden Pflanzensammlungen sich seit dem Aufkommen der Gensequenzierung in kahle Datenbanken zu verwandeln drohen. Und er verteidigt die alten Botanikertugenden der Beobachtung, Beschreibung und Klassifikation gegen eine undifferenzierte Betonung von Biodiversität, bei der nur die Vielfalt zähle und wie in einer Rumpelkammer alles "kreuz und quer" durcheinandergehe.
Aber kreuz und quer durcheinander geht leider auch sein Buch. Seiner eigenen Biographie folgend, die bei dem jungen Forscher im Wesentlichen die Geschichte seiner Promotion ist, berichtet er mal aus dieser, mal aus jener Weltregion, springt mal in diese und mal in jene Gelehrtenbiographie. Zu Beginn erzählt der Autor, wie er einen Pflanzenspross beobachtet, der sich durch den Stadtdschungel reckt, nur um einen Absatz später mitzuteilen, dass es um einen Samen geht, den er nicht auf der Straße, sondern in seinem Museum gefunden hat. Und so geht es leider weiter, manche Pointe erschließt sich nicht, Pflanzen wird "zum Wachsen geholfen", es wird in ihr Leben "eingedrungen", Bäume und Büsche "bilden Bruderschaften". Wenig einnehmend ist auch die exzessive Verwendung des Wörtchens "ich". Die als Mitautorin auf dem Cover genannte Journalistin, Dokumentarfilmerin und Landschaftsplanerin Charlotte Fauve wird nicht ein einziges Mal erwähnt, nur in der Danksagung ist aus dem "Ich" kommentarlos ein "Wir" geworden.
Am Ende der Lektüre ist man durchaus neugierig geworden auf die Botanik und ihre Versuche, Ordnung in die Pflanzenwelt zu bringen - und würde gerne ein etwas besser organisiertes Buch dazu lesen.
MANUELA LENZEN
Marc Jeanson
und Charlotte Fauve:
"Das Gedächtnis der Welt". Vom Finden und Ordnen der Pflanzen.
Aus dem Französischen von Elsbeth Ranke. Aufbau Verlag, Berlin 2020. 224 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
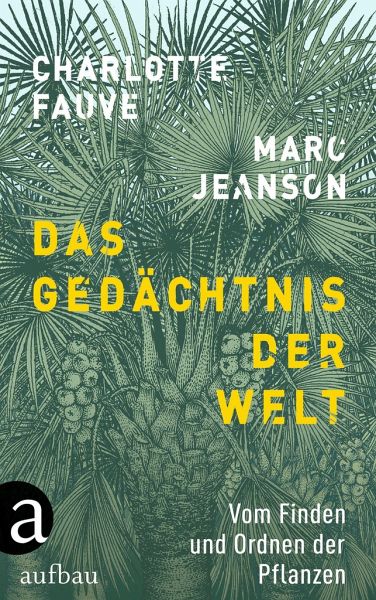






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.09.2020
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.09.2020