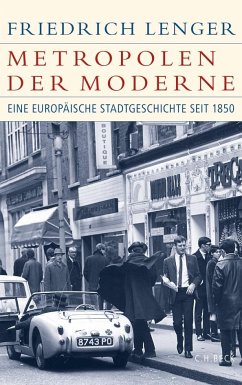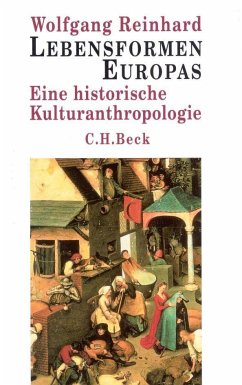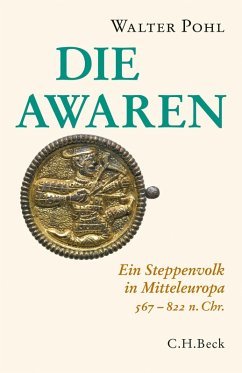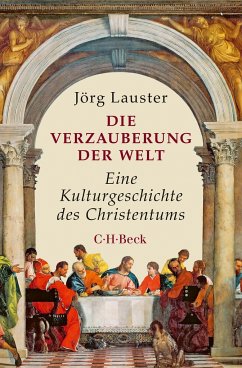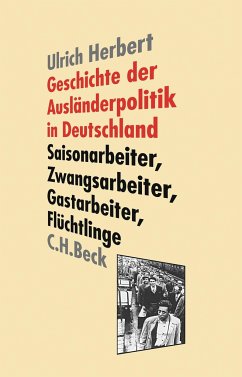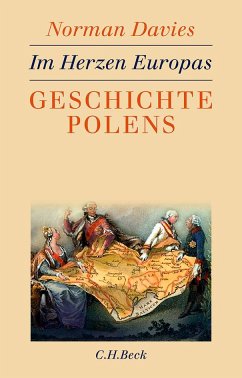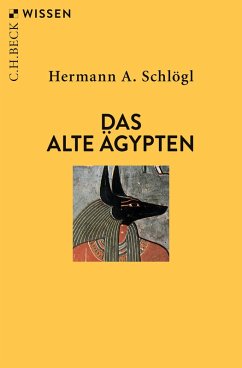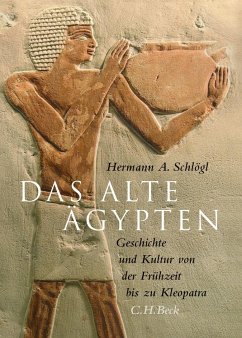Sinne, in Verbindung gebracht, der nach Otto Brunner (1958) die Sozialform des "ganzen Hauses" unter der Herrschaft des Hausherrn über Familie und Gesinde entsprochen hat. Wer in diesem Sinne für "Alteuropa" von 1800 nicht bis in die Antike zurückgehen möchte, sucht dessen Beginn meist im Mittelalter.
Diese Auffassung teilt der Berner Emeritus Peter Blickle. In einer neuen Darstellung möchte er zeigen, dass es vor der Moderne eine in sich geschlossene, "kompakte Form Europas" gegeben habe, die das späte Mittelalter seit 1200 und die frühe Neuzeit zugleich umfasste. Trotzdem ist Blickle kein Historist, denn wesentliche, noch heute verbindliche Werte Europas entstanden nach seiner Meinung in der Vormoderne; seine teleologische, auf die Gegenwart zulaufende Geschichtsauffassung verschärft eine apologetische Stimmungslage, mit der er Rumsfeld zu viel Ehre antut und die ihn zu kühnen Verallgemeinerungen verführt.
Antike, Christentum und Aufklärung seien der Wurzelgrund europäischer Werte; einige von ihnen seien mit Alteuropa untergegangen - Gehorsam, Disziplin und Treue -, andere als Errungenschaften der Vormoderne bis zu uns gelangt: Frieden, Freiheit und Ordnung. Als Universalschlüssel zur Vergangenheit dient Blickle eben das ganze Haus, in dem Frieden herrschte und das von außen unantastbar war. Es strahlte aber auch auf die vertikale Ordnung der alten Monarchien und die horizontalen Lebensgemeinschaften mit den Nachbarn in Dorf und Stadt sowie dem "öffentlichen Raum" dazwischen aus. Treibende Kraft hinter dieser Entwicklung seien erwiesenermaßen die Gemeinden gewesen. Vom gemeindlichen Frieden sei auch das "Ordnung machen" als eines der großen Projekte Europas ausgegangen, mit den staatlichen Systemen von Öffentlichem Recht, Privatrecht, Strafrecht und Verfahrensrecht als Resultat. In dem halben Jahrtausend Alteuropas sei ebenso die bis 1200 herrschende Zweiteilung der Gesellschaft in Freie, die herrschen, und Leibeigene, die dienen, überwunden und die "leibhaftige Freiheit" der Menschen durchgesetzt worden, "der reale Sockel, auf dem die (modernen) Menschenrechte stehen".
Blickle entwirft seine große Geschichtskonstruktion anhand vierer ineinander verstrebter Erscheinungen, die dem Alten Europa sein unverwechselbares Aussehen gegeben hätten: der Organisation von Macht und Gewalt über das Haus, der Sakralität und Spiritualität als Ethik des Mitleidens, der unterschiedlichen Dynamik der Entfaltung von Wirtschaft und Gesellschaft in einem durch Frieden geprägten Rechtsraum und schließlich der durch Unruhen beförderten Ordnung einer zivilisierten Gesellschaft. Sein Ansatz ist stark verfassungs- und ideengeschichtlich geprägt, der Autor schreibt Strukturgeschichte wie in den siebziger Jahren, er glaubt noch an die Überzeugungskraft von "Meistererzählungen" und damit an das Recht zur Hierarchisierung des mehr oder weniger Wichtigen. Was abweicht oder stört, wird marginalisiert, bagatellisiert oder bleibt schlicht unbeachtet. Historisch interessierte Leser, die sich inzwischen an eine stärker anthropologisch oder kulturwissenschaftlich geprägte Denkweise gewöhnt haben, werden an seiner Darstellung die Authentizität vermissen. Kritische Köpfe müssen sich an inneren Widersprüchen oder geleitet von äußeren Einwänden fast Seite für Seite aufreiben.
Ärgerlich ist schon, mit welcher Nonchalance Blickle über die seit langem bekannten Einwände gegen das historische Interpretament des "ganzen Hauses" hinweggeht. Brunner habe hier ohne jeden empirischen Quellenbeweis ein fundamentales Prinzip vormoderner Wirtschaft und Gesellschaft postuliert, schrieb gerade ein Kritiker, und die Grundannahme einer scharfen Trennung von traditionaler und moderner Wirtschaft gehe fehl. Nicht dem angeblichen Hausvater allein sei alle Gewalt zugekommen, sondern Ehefrauen, Gesinde und Verwandte hätten durchaus über eigene Ökonomien verfügt.
Anfechtbar ist auch Blickles Annahme, dass die Gemeinden die Entstehung der Häuser vorausgesetzt hätten, "also in der Regel nicht vor dem 13. Jahrhundert" entstanden, dann aber in ihrem "Siegeszug" in der politischen Realität Europas nicht aufzuhalten gewesen seien. Denn zweifellos kannte bereits die Karolingerzeit die für die Kommunen grundlegende Form der Verbrüderung und coniuratio, während sich umgekehrt schon Mitte des 13. Jahrhunderts wieder die Verherrschaftlichung genossenschaftlicher Eidverschwörungen durchzusetzen begann.
Bezeichnend für den Stil der Generalisierung, der einzelne wertvolle Erkenntnisse geradezu entwertet, ist auch, wie der Autor mit der Frömmigkeitsgeschichte umgeht. Aus der richtigen Beobachtung der spätmittelalterlichen und reformationszeitlichen Kreuzesverehrung an Bildern, Gebetstexten, theologischen Traktaten und besonders den von ihm so fleißig erschlossenen Quellen zu bürgerlichem und bäuerlichem Ungehorsam leitet Blickle die These ab, das Mitleiden, nicht aber die Nächstenliebe sei eine gelebte Norm im christlichen (Latein-)Europa gewesen.
Allerdings korrigiert er sich selbst an anderer Stelle und stellt (gewiss zutreffend) fest, "die aufopferungsvolle, keine Gegenleistung fordernde caritas (bildete) mit ihrer Hinwendung zum Mitmenschen und Mitbürger gewissermaßen das soziale Netz der alteuropäischen Gesellschaft, dem nichts auch nur annähernd Vergleichbares zur Seite stand, am wenigsten der Staat". Leider könnte man mit dergleichen Monita fortfahren. Blickles Buch fehlt die Überzeugungskraft, weil Europas Geschichte nie in einer gedachten Einheit aufgeht; Identitätsbehauptungen haben nur Anspruch auf Akzeptanz, wenn sie mit Einschränkungen oder Widersprüchen zu sich selbst ausbalanciert werden.
MICHAEL BORGOLTE
Peter Blickle: "Das Alte Europa". Vom Hochmittelalter bis zur Moderne. Verlag C. H. Beck, München 2008. 320 S., 16 Abb., geb., 26,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
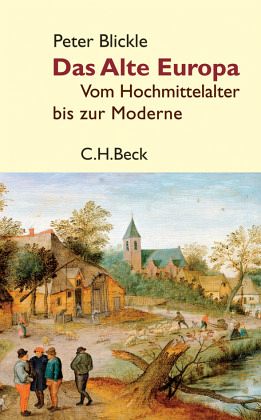






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.08.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 13.08.2008