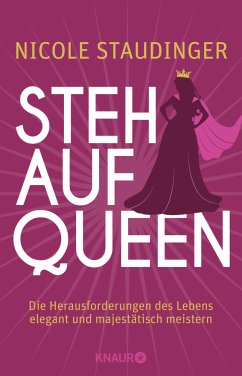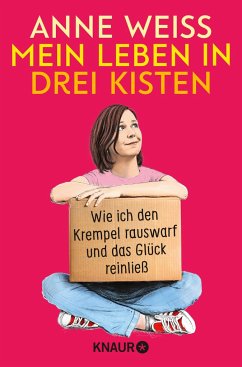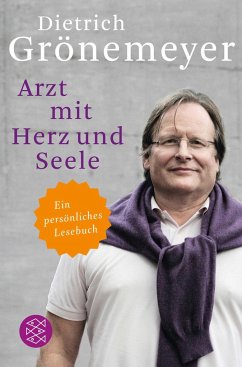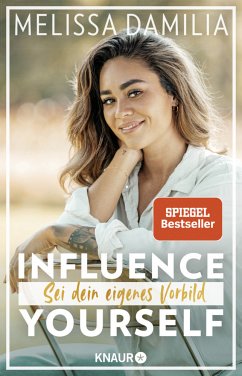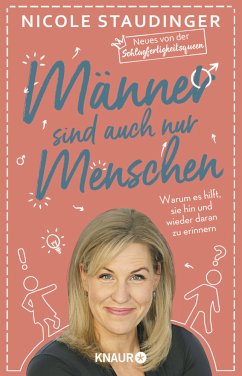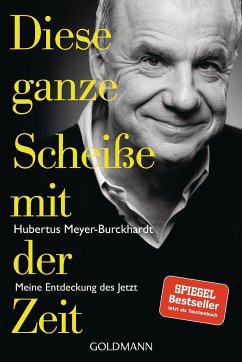Nicht lieferbar
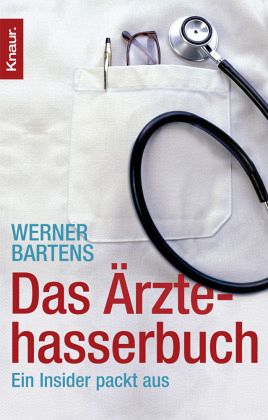
Das Ärztehasserbuch
Ein Insider packt aus
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Die Ärzte: arrogant, unnahbar, dilettantisch. Die Patienten: wehrlos. Ob sie an einen Quacksalber oder eine Koryphäe geraten sind, wissen Patienten erst, wenn es zu spät ist. Auf Gedeih und Verderb sind sie den Ärzten ausgeliefert.Der Arzt und Medizinjournalist Werner Bartens weiß aus eigener Erfahrung, wie es in den Praxen und Krankenhäusern zugeht: Zu viele Technokraten und Versager verbergen sich unter dem weißen Kittel. Schonungslos berichtet er von Größenwahn, Pfusch und Ignoranz. Seine Diagnose: Wir sollten aufhören, nur über die Kosten des Gesundheitswesens zu reden, und uns ...
Die Ärzte: arrogant, unnahbar, dilettantisch. Die Patienten: wehrlos. Ob sie an einen Quacksalber oder eine Koryphäe geraten sind, wissen Patienten erst, wenn es zu spät ist. Auf Gedeih und Verderb sind sie den Ärzten ausgeliefert.
Der Arzt und Medizinjournalist Werner Bartens weiß aus eigener Erfahrung, wie es in den Praxen und Krankenhäusern zugeht: Zu viele Technokraten und Versager verbergen sich unter dem weißen Kittel. Schonungslos berichtet er von Größenwahn, Pfusch und Ignoranz. Seine Diagnose: Wir sollten aufhören, nur über die Kosten des Gesundheitswesens zu reden, und uns endlich wieder auf das Wesentliche konzentrieren - auf die Bedürfnisse der Menschen, die Hilfe beim Arzt suchen.
Der Arzt und Medizinjournalist Werner Bartens weiß aus eigener Erfahrung, wie es in den Praxen und Krankenhäusern zugeht: Zu viele Technokraten und Versager verbergen sich unter dem weißen Kittel. Schonungslos berichtet er von Größenwahn, Pfusch und Ignoranz. Seine Diagnose: Wir sollten aufhören, nur über die Kosten des Gesundheitswesens zu reden, und uns endlich wieder auf das Wesentliche konzentrieren - auf die Bedürfnisse der Menschen, die Hilfe beim Arzt suchen.