Beerdigung. Obwohl er es schon in die Emirate geschafft hat, kehrt er um, um in einer spektakulären Szene festgenommen zu werden. Nur, weil man seine Frau mit Folter bedroht?
Wie der Absturz mit dem Überläufer zusammenhängt, wird sich erst am Ende von Lorraine Adams zweitem Roman "Crash" herausstellen. Das Buch erschien vergangenes Jahr unter dem enigmatischen Titel "The Room and the Chair" in den Vereinigten Staaten; seine Autorin trat damit den Beweis an, dass sie im Genre des literarischen Thrillers fortan zu den Schwergewichten zu zählen ist. Die Pulitzer-Preisträgerin des Jahre 1992 gab ihre Anstellung bei der "Washington Post" vor zehn Jahren auf, weil sie das Gefühl nicht loswurde, mit investigativem Journalismus sei es dort nicht so weit her, wie die traditionsreiche Zeitung gern behauptet. In der Figur der Mabel als Gemahlin des Bob-Woodward-artigen Sachbuchautors Don Grady könnte feine Selbstironie stecken: Lorraine Adams ist mit dem Schriftsteller Richard Price verheiratet, der ihr seit der Serie "The Wire" an Ruhm einiges voraus hat.
Dass zwei Frauen im Zentrum stehen, passt in die Zeit, die nach Heldinnen giert. Und die Welt der Presse ist für Adams ein Heimspiel: Genüsslich rechnet sie mit Ressorteitelkeit und Zuständigkeitsgespreize ab, die den täglichen Kampf im Nachrichtengeschäft behindern. Sie installiert mit Vera eine schwarze Reporterin, die von ganz unten kommt und sich an die Spur des Jet-Absturzes heftet. Vera fördert zu Tage, dass eine Frau im Cockpit saß; und sie findet eine minderjährige Prostituierte, die sich in der Nähe der Absturzstelle aufhielt.
Die Pilotin Mary Goodwin, verschlossene Vertreterin des militärisch-technischen Komplexes, kommt mit einer schauderhaften Kindheitsgeschichte zur Luftwaffe und hat sich dort aufgrund ihrer exzentrischen Flugmanöver den Spitznamen "X" wie "Extra" erflogen. Den Absturz hat nicht sie verschuldet, sie wurde Opfer der digitalen Kriegskunst. Ein System namens "Prophet" kann die Bordelektronik von Flugzeugen ausschalten und gegnerische Computer so manipulieren, dass diese Nachrichten und Befehle nicht länger als Feindmaterial zuordnen können.
Dahinter steckt eine Tarnfirma namens Media Exploitation Component Services. Sie sammelt die ganze digitale Beute des "Kriegs gegen den Terror" und wertet sie an zentraler, völlig unscheinbarer Büroadresse in Washington aus. Darunter sind Videos von Hinrichtungen, Schnappschüsse auf erbeuteten Handys, Mailverkehr auf Festplatten. MECS wird geleitet von Will "Chair" Holmes, einem ehemaligen Elitesoldaten, der unzufälligerweise auch der Führungsoffizier des verschollenen Atomwissenschaftlers Hossein ist. Holmes steckt auch hinter dem Absturz des Kampfjets, und er sorgt dafür, dass Mary Goodwin nach Afghanistan versetzt wird - sie soll nicht erst auf die Idee kommen, Fragen zu stellen. Das tut Vera schon für sie, deren Recherche-Fortschritte er mit einer gewissen Sympathie verfolgt, die ihn als Fachmann für Desinformation aber nicht wirklich beunruhigen. Dieses Katz-und-Maus-Spiel ist ebenso intelligent beschrieben wie der Crash, auf den die Redaktion der Zeitung zusteuert. Es gibt nämlich einen Bericht für den Geheimdienstausschuss des Senats, in dem die Hintergründe des brisanten "Potomac-Pilot"-Falles stehen. Die Konkurrenz, "die andere Zeitung", hat den Bericht, deutet ihn aber offensichtlich nicht richtig. Das Washingtoner Blatt hat ihn auch, sogar zweimal, weiß es aber die längste Zeit nicht.
Kein "D. C."-Roman ohne eine Spur von Watergate und dem Filmklassiker "Die Unbestechlichen". Aber auch der große Gesellschafts-Panoramamaler Gore Vidal schwingt mit seinem 1967 erschienenen "Washington, D. C." mit. Lorraine Adams unterläuft die Erwartungen, die sich mit dem Genre des Hauptstadt-Geheimdienstthrillers verbinden. Gleich nach dem Absturz heißt es über Mary: "In den Washington-Thrillern, die sie als Teenager verschlungen hatte, wäre sie ein verwegenes Weib." An anderer Stelle mokiert sich die Autorin über das "Washingtoner Melodram", das voll sei von "toten Briefkästen, Trenchcoats auf einer Bank vor dem Lincoln Center, Treffen in Tiefgaragen, einem ausgefuchsten Killer". Ihre Antwort darauf ist ein poetisches Verfahren, das den Faktenreichtum dieser Prosa überhöht. Lorraine Adams schreibt nicht auf den allfälligen Cliffhanger zu, sie bevorzugt schwebende Ausgänge. Stimmungen und Farben werden verdichtet: Hosseins Koffer "war Millionen von Kilometern gereist und hatte die Farbe eines im Schatten schlafenden Esels angenommen".
Ein Washingtoner Melodram ist "Crash" zum Glück nicht geworden, sondern ein komplex konstruierter, sprachlich die Üblichkeiten fiktionaler Serienfertiger überragender Roman. Die Menge des recherchierten Materials - die Autorin hat sich dem Vernehmen nach in Afghanistan sowie in Geheimdienstkreisen umgetan - hilft ihr, den eigenen, hohen Wahrheitsanspruch zu fundieren. Desinformation als Mittel im politischen und militärischen Kampf steht im einundzwanzigsten Jahrhundert höher im Kurs als je zuvor in der Geschichte. Diesem Umstand trägt Adams Rechnung, aber sie wagt sich auch an eine Einordnung über Folgen dieser Technologie. So sickert sie leise ein in die Gemütszustände amerikanischer Jetpiloten, ehrgeiziger Newsroom-Mönche sowie eines dreizehnjährigen kurdischen Knaben, der bei einer Aktion hinter den feindlichen Linien sein Leben riskiert - in einem Land, um das seit viertausend Jahren gekämpft wird. Der "Thrill" kommt in diesem Buch langsam, aber dafür hält er noch an, wenn die erzählte Geschichte zu Ende ist.
Lorraine Adams. "Crash". Roman.
Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow. Arche Literaturverlag, Hamburg 2011. 397 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
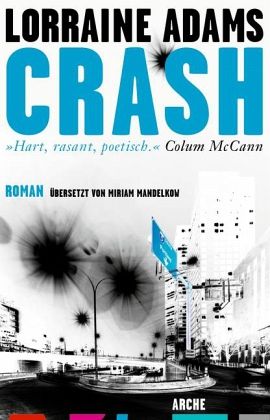




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2011
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2011