intellektuellen Platz gefunden haben und nicht selten irgendwo im Niemandsland zwischen Bauch und Kopf herumstöbern. Mitreden: ja, Arbeit an der überfälligen Begründung eines eigenen Faches: nein - so ließe sich das Dilemma charakterisieren.
"Cotta's Kulinarischer Almanach" könnte da eine positive Rolle spielen. Nutzt man also die Chance? Das Thema der vierzehnten, seit dem Jahr 2002 von Erwin Seitz herausgegebenen Ausgabe lautet "Alltag und Feste". Zunächst fällt auf, daß hier kein Alltag im Sinne eines Berichtes über die letzten zehn Minuten eines Schweines gemeint ist. Es geht um "Lunch in New York" oder "Lust auf Apéro in Zürich", wie überhaupt über der Textauswahl ein kleiner Hauch von verändertem Zielgruppendenken zu liegen scheint, den man ansonsten eher in den kommenden und gehenden Lifestyle-Magazinen antrifft - Whisky und Zigarren eingeschlossen. In dieser Welt darf es nicht zu realistisch sein, nicht zu nah und schon gar nicht anstrengend. "Wenn von Gang zu Gang jede Speise einen Schwall von Differenzen bietet, hell-dunkel, kalt-warm, weich-knusprig, mild-scharf, französisch-mediterran, mediterran-asiatisch, fühle ich mich regelrecht ermüdet", stöhnt der Herausgeber schon in seinem "Hors d'OEuvre". Droht hier vielleicht eine der leider immer wieder vorkommenden Phasen intellektueller Ermattung, und das, bevor es noch richtig losgegangen ist? Die Texte im einzelnen sind sehr unterschiedlich.
Einen überfälligen Beitrag liefert Niklas Maak mit einer Sicht auf die in der Tat oft extrem sinnlose bis antikulinarische Innenarchitektur von Restaurants ("Der Bauch der Architekten"). "Wie beim Essen selbst, kann man auch einen Raum zerkochen, er kann zu hart oder zu weich, geschmacklos oder versalzen sein", heißt es da, und dabei hat der Autor noch eher zeitgenössische Restaurants in Berlin im Visier und nicht etwa süddeutsche Orgien in Holz und Nippes. Anke Schipp setzt sich mit dem Servicepersonal in Restaurants auseinander und perpetuiert damit - ohne dies zu thematisieren - ein eigentlich typisch deutsches Problem, das in anderen Ländern in diesem Ausmaß kaum bekannt ist ("Der Geist des Hauses"). Da darf etwa einerseits der Auftritt von Kellnern "nie den des Gastes überbieten" (was in vielen Fällen kaum möglich sein dürfte), andererseits empfindet sie "nacktes Grauen", wenn man in der Systemgastronomie mit "Hallo, mein Name ist Stefan. Was kann ich für Sie tun?" begrüßt wird. Hannelore Schlaffer beklagt die mangelnde Trennung zwischen Alltag und Fest ("Das alltägliche Fest") und kommt zu dem Schluß, daß "der Reiz der heutigen Festgenüsse gerade in ihrer Verfügbarkeit zu jeder Zeit und an jedem Ort" liegt. Einen solchen Ansatz würde man sich in einer etwas breiteren Form wünschen, um zum Beispiel die subjektiven Aspekte des Festlichen noch weiter auszuführen.
Nach diesen Texten wendet sich der Almanach "klassischen" Inhalten nach Art eines Reiseteils zu. Rosa Kremel beschreibt "Das Hammelfest in Marrakesch", Antje Susann Bonhage das "Essen in Peking", Peter Eickhoff einen Streifzug durch Wiener Restaurants ("Des Kaisers neue Küche"). Ein auffälliges Thema sind "Die Köche des Vatikan", weil Alexander Smoltczyk in seinem leider viel zu knappen Text hier näher an die - erwartungsgemäß moderat ausgeprägten - Eßgewohnheiten der Kirchenfürsten herankommt. Wäre dies keine Gelegenheit für einige Stimmen zum Essen von dieser Seite aus gewesen?
Trotz der schönen Farbflecken schleicht sich vor allem beim Lesen der "Reiseberichte" manchmal das Gefühl ein, in einem Reader's-Digest-Heft der fünfziger Jahre gelandet zu sein, in dem risikolose Themen gefällig einherplätschern, in dem man einen Hauch von Pennälerdenken zu verspüren meint, also jener leichten Distanz, die nicht durch allzu tiefes Denken behindert wird und immer ein paar Dinge zuviel als Kuriosität betrachtet.
Wenn andererseits Denis Scheck über "Speis und Trank in Entenhausen" schreibt, wird sofort deutlich, was der Unterschied zwischen einer Art direkten Schreibweise und den durch zuviel Gestaltungswillen vernebelten Ergüssen ist. Ausgerechnet die Comic-Realität wird mit viel sauberer Recherche verarbeitet. Ärgerlich dagegen ein "Soßenlexikon" von David Wagner, das vor allem von gängigen Klischees ("Wer setzt denn wirklich kaltes Wasser mit Knochen an und kocht diese mindestens drei Stunden aus?") und mangelndem Sachwissen geprägt ist ("Sojasauce. Sushimaggi", als ob es keine hervorragenden Sojasaucen gäbe) und ganz auf der Pennälerlinie liegt.
Zu den starken Momenten gehört der Rezeptteil. Zuerst kocht der Berliner Spitzenkoch Bobby Bräuer sieben Gänge mit Innereien vom Kalb und leistet auf diese Weise einen Beitrag zur weiteren Emanzipation aller Teile eines Tieres, das in der Spitzenküche leider allzusehr auf sein angeblich bestes Bestandteil (das Filet) reduziert wird. Danach nimmt Herausgeber Seitz die alte Tradition des Kalenders in einem Almanach auf und präsentiert den "Deutschen Küchenkalender 2007" mit Rezepten von Christian Mittermeier und Jürgen Koch. Diese Auswahl, unter anderem mit Hopfensprossen, gefülltem Gänsehals und "Spießchen von der Albschneck", läßt Programm erkennen. Die Whisky- und Zigarrenabteilung ist mit Michael Allmaier ("Ein paar Bemerkungen zum Whisky") und Verlags-Chef Michael Klett ("Schwebeträume. Gedanken beim Schmauchen feiner Zigarren") zwar gut besetzt, belastet aber das mögliche Konzept.
Natürlich kann man die Kritik an zu wenig Risiko und Meinung, an energischeren Bemühungen um die Verbesserung der kulinarischen Kultur nicht an einzelnen Büchern festmachen und schon gar nicht an einem Almanach, der sich jederzeit auf seine traditionelle Extraterritorialität zurückziehen kann. Aber man kann über den Geist verstimmt sein, der immer wieder das eine zuläßt und das andere nicht von sich gibt. Die Seite der distanzierteren Elegien hat also wieder ein Buch mehr. Für die Zukunft wünscht man sich mehr Glanz und weniger Hochglanz.
Erwin Seitz (Hrsg.): "Cotta's Kulinarischer Almanach. Nr. 14". Alltag und Feste. Mit Illustrationen von Isabel Klett. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2006. 247 S., geb., 21,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
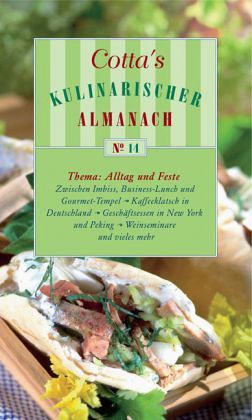





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.10.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.10.2006