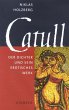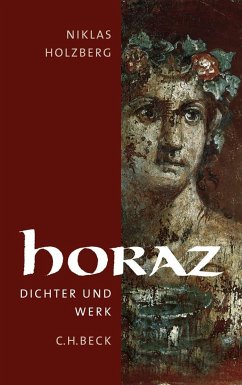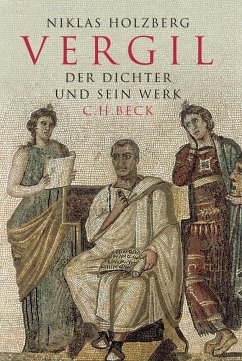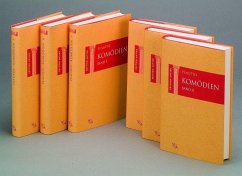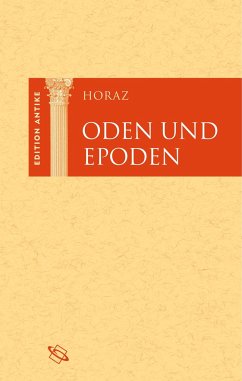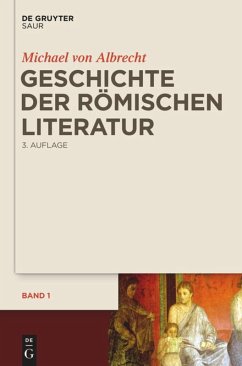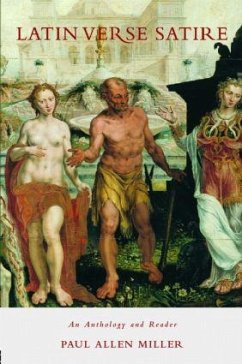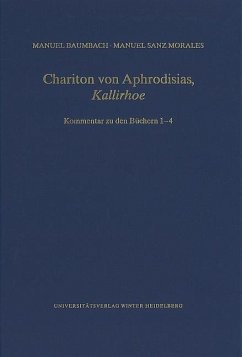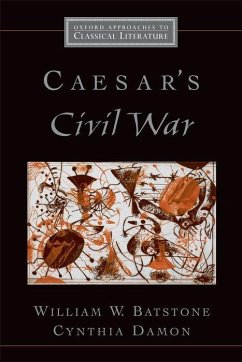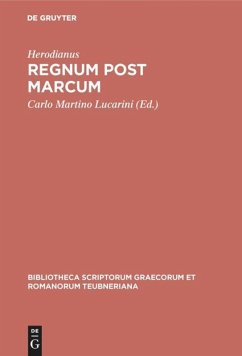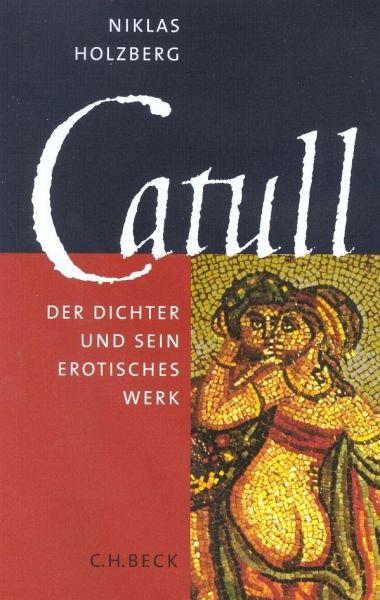
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar





Niklas Holzberg legt mit diesem Band die erste moderne deutschsprachige, für ein breites Publikum geschriebene Gesamtdarstellung über Leben und Werk des römischen Dichters Catull vor. Dabei bietet das Buch eine Orientierung über Catulls Stellung in der römischen Gesellschaft, aber auch über deren sexuelle Normen, mit denen der Dichter sein lockeres Spiel treibt. Im Zentrum dieses Wechselspiels von Zitat und leicht faßlicher Darlegung steht der Liebesdichter und damit - wie könnte es bei Catull auch anders sein - natürlich vor allem sein meist beißender Witz und seine Vorliebe für pr...
Niklas Holzberg legt mit diesem Band die erste moderne deutschsprachige, für ein breites Publikum geschriebene Gesamtdarstellung über Leben und Werk des römischen Dichters Catull vor. Dabei bietet das Buch eine Orientierung über Catulls Stellung in der römischen Gesellschaft, aber auch über deren sexuelle Normen, mit denen der Dichter sein lockeres Spiel treibt.
Im Zentrum dieses Wechselspiels von Zitat und leicht faßlicher Darlegung steht der Liebesdichter und damit - wie könnte es bei Catull auch anders sein - natürlich vor allem sein meist beißender Witz und seine Vorliebe für pralle Erotik. Es wird deutlich, welche Ordnung das Sexualleben Roms im 1. Jahrhundert v. Chr. bestimmte und welche Konsequenzen sich aus der Einhaltung oder aus einer Mißachtung dieser Normen für Römer und Römerinnen ergeben konnten.
Die zahlreichen - teils anmutigen, teils obszönen - Gedichtbeispiele wurden stilsicher ins Deutsche übertragen. Stets wird der poetische Gehalt der Verse, aber auch ihr Sim literarischen, politischen und gesellschaftlichen Leben erläutert.
Die tragikomische, in jeder Hinsicht wechselvolle Beziehung zwischen Catull und seiner Lesbia zeigen den Dichter zumeist als `unmännlich` Liebenden. Die Kunstfertigkeit, mit der Catull seine Hingabe an die Geliebte, aber auch seinen Hader mit dem Rest der Welt beschreibt, hat sein Publikum - damals wie heute - amüsiert und angeregt.
Im Zentrum dieses Wechselspiels von Zitat und leicht faßlicher Darlegung steht der Liebesdichter und damit - wie könnte es bei Catull auch anders sein - natürlich vor allem sein meist beißender Witz und seine Vorliebe für pralle Erotik. Es wird deutlich, welche Ordnung das Sexualleben Roms im 1. Jahrhundert v. Chr. bestimmte und welche Konsequenzen sich aus der Einhaltung oder aus einer Mißachtung dieser Normen für Römer und Römerinnen ergeben konnten.
Die zahlreichen - teils anmutigen, teils obszönen - Gedichtbeispiele wurden stilsicher ins Deutsche übertragen. Stets wird der poetische Gehalt der Verse, aber auch ihr Sim literarischen, politischen und gesellschaftlichen Leben erläutert.
Die tragikomische, in jeder Hinsicht wechselvolle Beziehung zwischen Catull und seiner Lesbia zeigen den Dichter zumeist als `unmännlich` Liebenden. Die Kunstfertigkeit, mit der Catull seine Hingabe an die Geliebte, aber auch seinen Hader mit dem Rest der Welt beschreibt, hat sein Publikum - damals wie heute - amüsiert und angeregt.
Niklas Holzberg lehrt als Professor für Klassische Philologie an der Universität München. Seine Forschungsleistungen und Publikationen auf dem Gebiet der römischen Dichtung haben internationale Anerkennung gefunden. Im Verlag C.H.Beck ist von ihm lieferbar: Ovid. Leben und Werk
Produktdetails
- Verlag: Beck
- 3. Aufl.
- Seitenzahl: 228
- Erscheinungstermin: Februar 2002
- Deutsch
- Abmessung: 226mm x 148mm x 21mm
- Gewicht: 428g
- ISBN-13: 9783406485312
- ISBN-10: 3406485316
- Artikelnr.: 10132640
Herstellerkennzeichnung
C.H. Beck
Wilhelmstrasse 9
80801 München
andreas.skasa@beck.de
+4989381890
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.07.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.07.2002Der sittenreine Jüngling in Rom
Etwas zu grell: Niklas Holzberg entdeckt den Radi bei Catull
Der Bundestag kennt die schöne Einrichtung einer "persönlichen Erklärung". Etwas Ähnliches sollte es auch für Rezensionen geben. Eine solche Neuerung wäre nützlich und zuweilen notwendig, und um dies zu beweisen, beginne ich mit einer solchen Erklärung und sage: Weder im Alltag noch gar bei Rezensionen in angesehenen Blättern gebrauche ich vulgäre Wendungen für sexuelle Aktivitäten. Aber wenn ich das grell-bemerkenswerte Buch von Niklas Holzberg über den römischen Dichter Catull (der im 1. Jahrhundert vor Christus lebte) rezensieren soll, komme ich, um von seiner Tonart einen Eindruck zu geben, um obszöne Ausdrücke nicht
Etwas zu grell: Niklas Holzberg entdeckt den Radi bei Catull
Der Bundestag kennt die schöne Einrichtung einer "persönlichen Erklärung". Etwas Ähnliches sollte es auch für Rezensionen geben. Eine solche Neuerung wäre nützlich und zuweilen notwendig, und um dies zu beweisen, beginne ich mit einer solchen Erklärung und sage: Weder im Alltag noch gar bei Rezensionen in angesehenen Blättern gebrauche ich vulgäre Wendungen für sexuelle Aktivitäten. Aber wenn ich das grell-bemerkenswerte Buch von Niklas Holzberg über den römischen Dichter Catull (der im 1. Jahrhundert vor Christus lebte) rezensieren soll, komme ich, um von seiner Tonart einen Eindruck zu geben, um obszöne Ausdrücke nicht
Mehr anzeigen
herum, denn in seinem Buch wimmelt es von solchen.
Der Münchener Ordinarius für Klassische Philologie erlaubt sich die freiestmögliche Ausdrucksweise. Niemand wird seine Sachkenntnis bestreiten. Er führt anschaulich, kenntnisreich und direkt ein in Catulls erotisches Werk. Er kennt die Catull-Forschung gut, auch wenn er nicht viel von seinen Vorgängern hält, denn die waren ihm fast alle zu prüde. Er hat ein Gefühl für poetische Form und kann in deren Analyse einführen. Er läßt sich auf das sprachliche Detail ein, erklärt einzelne Wendungen und bezieht die Gedichte Catulls auf dessen literarische Vorlagen und auf die römischen Vorstellungen vom sexuellen Leben.
Sicherlich ist da vieles rühmenswert und manches zu lernen. Aber, offen gesagt, der bürgerlich erzogene Leser muß schon manchmal nach Luft schnappen. Holzberg übertreibt die Enthüllungstechnik. Er kann einwenden, die Schweinereien stünden nun halt einmal bei Catull, Catull sei ein Klassiker, und wer seine literarischen Anspielungen und amüsanten Spielereien in seinem schmalen lyrischen Werk von gut hundert Gedichten erkenne, entdecke einen großen Schriftsteller. Dem ist kaum etwas zu erwidern, und doch stört der vulgäre Ton.
Um dies vorzuführen, genügt ein minder krasses Beispiel. Die Sache fängt harmlos an: Rettiche sind ein argloses Gewächs, und ein Münchener Radi steht wohl unter dem besonderen Schutz der Patrona Bavariae. Fische haben schon eher etwas Glitschiges und Schlüpfriges an sich, aber wenn man den philosophischen Anregungen des Kardinals Ratzinger folgt, haben auch sie, die leicht entschlüpfen, einen festen Ort in der Schöpfungsordnung. Aber was muß man über Rettiche und Fische bei unserem Münchener Professor lesen? Catull war in den Knaben Juventius verliebt und drohte dem Konkurrenten Aurelius, falls er sich an seinem Knaben vergreift, "die anale Penetration mit Rettichen und Fischen an".
Das ist anschaulich gesagt und beruht auf gelehrten Recherchen. Aber ganz so sagt es ein Herr Pfarrer nicht. Es ist eingebaut in eine Untersuchung über Themenblöcke im lyrischen Werk Catulls: Neben dem Aurelius- und Furius-Zyklus, "in dem auffallend viele unflätige Ausdrücke verwendet sind", steht da der Lesbia-Komplex, "der von obszöner Sprache frei ist". Das gibt es also doch bei Catull: Gymnasiallehrer können auch künftig ein minder anstößiges Catull-Gedicht aussuchen, und Holzbergs Leser schöpfen Hoffnung, aus dem Malstrom böser Wörter einstens aufzutauchen.
Ich wette darauf, daß es mehr als einen Fachkollegen gibt, der wegen dieser Tonart das Buch nicht zu Ende liest. Nehmen wir an, ein solcher Philologe sei selbst ein bedeutender Catull-Forscher, dann mag das schadlos hingehen, aber wer über Catulls Gedichte noch etwas zu lernen hat, muß durch dieses Buch durch. Nennen wir es in Holzbergscher Ungeniertheit ruhig die "Bettspalte der Altphilologie", es bringt auf amüsante Art Neues. Holzberg geht nicht von der Biographie Catulls aus. Wir wissen von ihr sehr wenig: Catull stammt aus Verona; seine Gedichtsammlung ist um 50 vor Christus entstanden; sie läßt auf den Aufenthalt in Rom und auf die Bekanntschaft mit berühmten Männern wie Cicero, Caesar und Cornelius Nepos schließen. Das ist alles. Holzberg macht aus dieser Biographennot eine Philologentugend und betrachtet das "ich" der Gedichte als poetisches Ich. Dann ist auch Catulls Lesbia ein poetisches Konstrukt, und der Leser ist gut beraten, wenn er auch um die physische Existenz von Dantes Beatrice und Petrarcas Laura zu bangen beginnt. Davon ungerührt, belehrt uns der Autor, die Gedichte nicht länger in einer immer nur hypothetischen biographisch-chronologischen Anordnung zu lesen, sondern in der Abfolge der Gedichtsammlung. Das Interesse verlagert sich von der Biographie auf die Komposition der Themenblöcke.
Holzbergs methodisches Konzept sieht einen zweiten Schritt vor: Er deckt in den Gedichten Catulls Anklänge an frühere griechische und lateinische Dichtungen auf. Er nennt das, wie es die Mode gebietet, "Intertextualität". Er zeigt insbesondere die Präsenz Sapphos in Catulls Texten, an die schon der Name "Lesbia" denken läßt. Er handhabt dieses Instrument der Analyse interner Textverweise virtuos, und damit gelingt es ihm, literarische Finessen sichtbar zu machen, die der schlichte Leser übersehen würde. Catulls Gedichte sind keine naive Lyrik, sondern ein raffiniertes Spiel mit einem Gemisch aus Kulturmüll, Seelenausdruck und Obszönität. Aber das ist nur die stoffliche Seite; Catulls Gedichte sind Formkunstwerke, und Holzberg zeigt dies im einzelnen durch Analysen ihrer metrischen Struktur. Der Sinn für Versmaße ist in Deutschland nicht mehr weit verbreitet; Holzbergs Buch bietet eine gute Einführung in Grundbegriffe der antiken Metrik. Zuweilen wünscht der Leser, der Autor wäre in dieser Art Elementarunterricht noch etwas weitergegangen. Wer weiß denn schon, was "Galljamben" sind? Das Wort kommt in keinem Lexikon vor; nicht einmal der Duden verzeichnet es, aber der Verfasser gebraucht es, ohne es zu erklären. Aber das ist bei ihm die Ausnahme; ansonsten glänzt er durch didaktisches Geschick und deftige Popularität.
Holzbergs Buch zeichnet sich aus durch Frische des Blicks und Frechheit des Ausdrucks. So etwas kommt auf dem Gebiet der soliden Altertumswissenschaften selten vor. Holzberg hat von seiner Art saftiger Philologie schon vor Jahren mit seinem Ovid-Buch (ebenfalls im Verlag C. H. Beck) eine Probe gegeben. Trotzdem gerät der Leser ins Grübeln, wie eine solche Vereinigung von Gelehrsamkeit und sprachlichem Übermut wohl zustande gekommen sein mag. Nun lernt er gerade bei Holzberg, wie wenig er sich auf biographische Rekonstruktionen verlassen kann.
Trotzdem versucht er es, und vielleicht hilft ihm dabei folgende Hypothese: Holzberg ist 1946 geboren. Unschwer läßt sich vorstellen, wie Catull behandelt worden ist, als unser Autor 1964 in der Unterprima saß. Da hieß es, Catull sei ein sittenreiner Jüngling aus der sittenreinen Stadt Verona gewesen, er sei in der sittenreinen Provinz Gallia Cisalpina unter der Obhut eines sittenreinen Vaters aufgewachsen, der nur den Fehler gemacht habe, diesen Musterjüngling in die sittenlose Hauptstadt Rom zum Studium zu schicken. Dort verliebte der zarte Dichter sich in die Ehefrau des Metellus, und damit begann die Verderbnis und die Enttäuschung über verführerische und flatterhafte Frauen.
Vor diesem biographischen Hintergrund wird der Gymnasiallehrer einige weniger schlüpfrige Catull-Gedichte ausgewählt und als Beispiel berechtigter Empörung über den Sittenverfall in der Zeit der untergehenden Republik ausgelegt haben. Aber ein gewitzter Primaner las in löblicher Neugierde in seiner Catull-Ausgabe, die wegen ihres schmalen Umfangs zum Weiterlesen förmlich einlädt, ganz andere Dinge, frivolere und amüsantere. Ein aufgeweckter Primaner wollte damals heraus aus der Prüderie der Adenauer-Zeit. Wenn er weiterlas in seinem Catull, konnte er unschwer entdecken: Dieser Dichter ließ sich nicht friedlich einfügen in die Welt des soeben wieder christlich-traditionell stilisierten humanistischen Gymnasiums. Dazu waren seine Gedichte zu übermütig und zu unanständig.
Der junge Leser stand vor der Wahl: Entweder Catull oder Gertrud von Le -Fort. Auch Bergengruen und Hermann Hesse konnten ihm nicht helfen. Wenn er Lateinisch lesen konnte und einen klaren Kopf hatte, wählte er Catull. In den siebziger Jahren kamen ihm die Forschungen von Michel Foucault zur Geschichte der antiken Sexualität entgegen. Jetzt war es endgültig aus mit der edlen Einfalt der Lateinlehrer. Foucault hat die Eigenart der antik-römischen Sexualordnung scharf gezeichnet: Sie ordnete sexuelle Beziehungen weniger durch die Geschlechterdifferenz als durch Machtverhältnisse. Holzberg drückt das in seiner unnachahmlichen Schreibkunst folgendermaßen aus:
"Es wurde nicht eigentlich zwischen männlich und weiblich und überhaupt nicht zwischen hetero- und homosexuell unterschieden - diese Begriffe waren der heidnischen Antike vollkommen fremd -, sondern zwischen mächtig und machtlos beziehungsweise aktiv und passiv. Da bei sexuellen Handlungen der Vorgang der Penetration den absoluten Vorrang hatte, standen sich ganz einfach Penetrierende und Penetrierte gegenüber." Zur ersten Gruppe gehörten mächtige Männer, zur zweiten Frauen, Knaben und passiv agierende Homosexuelle.
Dies waren Holzbergs Ausgangspunkte: prüde Philologen, die Kargheit des biographischen Materials, die Intertextualität, das Interesse an Komposition der Carmina-Sammlung, die Aufmerksamkeit auf Rhythmus und Metrum und schließlich die Foucaultsche Sexualhistorie.
Der Professor in Bayern brauchte nur noch den Radi bei Catull zu entdecken, und seine Catull-Auslegung war fertig. Seine literarischen Gegner werden behaupten, er leide unter einer sexuellen Obsession. Tatsächlich hört er überall sexuelle Konnotationen. Er kann nicht einmal das unschuldige lateinische Wort für "Bimsstein" lesen, ohne - sit venia verbo, aber so schreibt er halt - ans Bumsen zu denken, denn mit dem Bimsstein rieben passive männliche Homosexuelle sich die Haare an den Beinen ab und wirkten dadurch attraktiver.
Die Machart des Buches ist etwas zu laut, aber nehmt alles nur in allem: Lest das Buch, es ist gelehrt und zudem amüsant. Einen besonderen Applaus verdienen seine Prosaübersetzungen zahlreicher Gedichte. Ihr werdet einen neuen Catull kennenlernen und befriedigt ein originelles Buch aus der Hand legen.
KURT FLASCH
Niklas Holzberg: "Catull". Der Dichter und sein erotisches Werk. C. H. Beck Verlag, München 2002. 228 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Der Münchener Ordinarius für Klassische Philologie erlaubt sich die freiestmögliche Ausdrucksweise. Niemand wird seine Sachkenntnis bestreiten. Er führt anschaulich, kenntnisreich und direkt ein in Catulls erotisches Werk. Er kennt die Catull-Forschung gut, auch wenn er nicht viel von seinen Vorgängern hält, denn die waren ihm fast alle zu prüde. Er hat ein Gefühl für poetische Form und kann in deren Analyse einführen. Er läßt sich auf das sprachliche Detail ein, erklärt einzelne Wendungen und bezieht die Gedichte Catulls auf dessen literarische Vorlagen und auf die römischen Vorstellungen vom sexuellen Leben.
Sicherlich ist da vieles rühmenswert und manches zu lernen. Aber, offen gesagt, der bürgerlich erzogene Leser muß schon manchmal nach Luft schnappen. Holzberg übertreibt die Enthüllungstechnik. Er kann einwenden, die Schweinereien stünden nun halt einmal bei Catull, Catull sei ein Klassiker, und wer seine literarischen Anspielungen und amüsanten Spielereien in seinem schmalen lyrischen Werk von gut hundert Gedichten erkenne, entdecke einen großen Schriftsteller. Dem ist kaum etwas zu erwidern, und doch stört der vulgäre Ton.
Um dies vorzuführen, genügt ein minder krasses Beispiel. Die Sache fängt harmlos an: Rettiche sind ein argloses Gewächs, und ein Münchener Radi steht wohl unter dem besonderen Schutz der Patrona Bavariae. Fische haben schon eher etwas Glitschiges und Schlüpfriges an sich, aber wenn man den philosophischen Anregungen des Kardinals Ratzinger folgt, haben auch sie, die leicht entschlüpfen, einen festen Ort in der Schöpfungsordnung. Aber was muß man über Rettiche und Fische bei unserem Münchener Professor lesen? Catull war in den Knaben Juventius verliebt und drohte dem Konkurrenten Aurelius, falls er sich an seinem Knaben vergreift, "die anale Penetration mit Rettichen und Fischen an".
Das ist anschaulich gesagt und beruht auf gelehrten Recherchen. Aber ganz so sagt es ein Herr Pfarrer nicht. Es ist eingebaut in eine Untersuchung über Themenblöcke im lyrischen Werk Catulls: Neben dem Aurelius- und Furius-Zyklus, "in dem auffallend viele unflätige Ausdrücke verwendet sind", steht da der Lesbia-Komplex, "der von obszöner Sprache frei ist". Das gibt es also doch bei Catull: Gymnasiallehrer können auch künftig ein minder anstößiges Catull-Gedicht aussuchen, und Holzbergs Leser schöpfen Hoffnung, aus dem Malstrom böser Wörter einstens aufzutauchen.
Ich wette darauf, daß es mehr als einen Fachkollegen gibt, der wegen dieser Tonart das Buch nicht zu Ende liest. Nehmen wir an, ein solcher Philologe sei selbst ein bedeutender Catull-Forscher, dann mag das schadlos hingehen, aber wer über Catulls Gedichte noch etwas zu lernen hat, muß durch dieses Buch durch. Nennen wir es in Holzbergscher Ungeniertheit ruhig die "Bettspalte der Altphilologie", es bringt auf amüsante Art Neues. Holzberg geht nicht von der Biographie Catulls aus. Wir wissen von ihr sehr wenig: Catull stammt aus Verona; seine Gedichtsammlung ist um 50 vor Christus entstanden; sie läßt auf den Aufenthalt in Rom und auf die Bekanntschaft mit berühmten Männern wie Cicero, Caesar und Cornelius Nepos schließen. Das ist alles. Holzberg macht aus dieser Biographennot eine Philologentugend und betrachtet das "ich" der Gedichte als poetisches Ich. Dann ist auch Catulls Lesbia ein poetisches Konstrukt, und der Leser ist gut beraten, wenn er auch um die physische Existenz von Dantes Beatrice und Petrarcas Laura zu bangen beginnt. Davon ungerührt, belehrt uns der Autor, die Gedichte nicht länger in einer immer nur hypothetischen biographisch-chronologischen Anordnung zu lesen, sondern in der Abfolge der Gedichtsammlung. Das Interesse verlagert sich von der Biographie auf die Komposition der Themenblöcke.
Holzbergs methodisches Konzept sieht einen zweiten Schritt vor: Er deckt in den Gedichten Catulls Anklänge an frühere griechische und lateinische Dichtungen auf. Er nennt das, wie es die Mode gebietet, "Intertextualität". Er zeigt insbesondere die Präsenz Sapphos in Catulls Texten, an die schon der Name "Lesbia" denken läßt. Er handhabt dieses Instrument der Analyse interner Textverweise virtuos, und damit gelingt es ihm, literarische Finessen sichtbar zu machen, die der schlichte Leser übersehen würde. Catulls Gedichte sind keine naive Lyrik, sondern ein raffiniertes Spiel mit einem Gemisch aus Kulturmüll, Seelenausdruck und Obszönität. Aber das ist nur die stoffliche Seite; Catulls Gedichte sind Formkunstwerke, und Holzberg zeigt dies im einzelnen durch Analysen ihrer metrischen Struktur. Der Sinn für Versmaße ist in Deutschland nicht mehr weit verbreitet; Holzbergs Buch bietet eine gute Einführung in Grundbegriffe der antiken Metrik. Zuweilen wünscht der Leser, der Autor wäre in dieser Art Elementarunterricht noch etwas weitergegangen. Wer weiß denn schon, was "Galljamben" sind? Das Wort kommt in keinem Lexikon vor; nicht einmal der Duden verzeichnet es, aber der Verfasser gebraucht es, ohne es zu erklären. Aber das ist bei ihm die Ausnahme; ansonsten glänzt er durch didaktisches Geschick und deftige Popularität.
Holzbergs Buch zeichnet sich aus durch Frische des Blicks und Frechheit des Ausdrucks. So etwas kommt auf dem Gebiet der soliden Altertumswissenschaften selten vor. Holzberg hat von seiner Art saftiger Philologie schon vor Jahren mit seinem Ovid-Buch (ebenfalls im Verlag C. H. Beck) eine Probe gegeben. Trotzdem gerät der Leser ins Grübeln, wie eine solche Vereinigung von Gelehrsamkeit und sprachlichem Übermut wohl zustande gekommen sein mag. Nun lernt er gerade bei Holzberg, wie wenig er sich auf biographische Rekonstruktionen verlassen kann.
Trotzdem versucht er es, und vielleicht hilft ihm dabei folgende Hypothese: Holzberg ist 1946 geboren. Unschwer läßt sich vorstellen, wie Catull behandelt worden ist, als unser Autor 1964 in der Unterprima saß. Da hieß es, Catull sei ein sittenreiner Jüngling aus der sittenreinen Stadt Verona gewesen, er sei in der sittenreinen Provinz Gallia Cisalpina unter der Obhut eines sittenreinen Vaters aufgewachsen, der nur den Fehler gemacht habe, diesen Musterjüngling in die sittenlose Hauptstadt Rom zum Studium zu schicken. Dort verliebte der zarte Dichter sich in die Ehefrau des Metellus, und damit begann die Verderbnis und die Enttäuschung über verführerische und flatterhafte Frauen.
Vor diesem biographischen Hintergrund wird der Gymnasiallehrer einige weniger schlüpfrige Catull-Gedichte ausgewählt und als Beispiel berechtigter Empörung über den Sittenverfall in der Zeit der untergehenden Republik ausgelegt haben. Aber ein gewitzter Primaner las in löblicher Neugierde in seiner Catull-Ausgabe, die wegen ihres schmalen Umfangs zum Weiterlesen förmlich einlädt, ganz andere Dinge, frivolere und amüsantere. Ein aufgeweckter Primaner wollte damals heraus aus der Prüderie der Adenauer-Zeit. Wenn er weiterlas in seinem Catull, konnte er unschwer entdecken: Dieser Dichter ließ sich nicht friedlich einfügen in die Welt des soeben wieder christlich-traditionell stilisierten humanistischen Gymnasiums. Dazu waren seine Gedichte zu übermütig und zu unanständig.
Der junge Leser stand vor der Wahl: Entweder Catull oder Gertrud von Le -Fort. Auch Bergengruen und Hermann Hesse konnten ihm nicht helfen. Wenn er Lateinisch lesen konnte und einen klaren Kopf hatte, wählte er Catull. In den siebziger Jahren kamen ihm die Forschungen von Michel Foucault zur Geschichte der antiken Sexualität entgegen. Jetzt war es endgültig aus mit der edlen Einfalt der Lateinlehrer. Foucault hat die Eigenart der antik-römischen Sexualordnung scharf gezeichnet: Sie ordnete sexuelle Beziehungen weniger durch die Geschlechterdifferenz als durch Machtverhältnisse. Holzberg drückt das in seiner unnachahmlichen Schreibkunst folgendermaßen aus:
"Es wurde nicht eigentlich zwischen männlich und weiblich und überhaupt nicht zwischen hetero- und homosexuell unterschieden - diese Begriffe waren der heidnischen Antike vollkommen fremd -, sondern zwischen mächtig und machtlos beziehungsweise aktiv und passiv. Da bei sexuellen Handlungen der Vorgang der Penetration den absoluten Vorrang hatte, standen sich ganz einfach Penetrierende und Penetrierte gegenüber." Zur ersten Gruppe gehörten mächtige Männer, zur zweiten Frauen, Knaben und passiv agierende Homosexuelle.
Dies waren Holzbergs Ausgangspunkte: prüde Philologen, die Kargheit des biographischen Materials, die Intertextualität, das Interesse an Komposition der Carmina-Sammlung, die Aufmerksamkeit auf Rhythmus und Metrum und schließlich die Foucaultsche Sexualhistorie.
Der Professor in Bayern brauchte nur noch den Radi bei Catull zu entdecken, und seine Catull-Auslegung war fertig. Seine literarischen Gegner werden behaupten, er leide unter einer sexuellen Obsession. Tatsächlich hört er überall sexuelle Konnotationen. Er kann nicht einmal das unschuldige lateinische Wort für "Bimsstein" lesen, ohne - sit venia verbo, aber so schreibt er halt - ans Bumsen zu denken, denn mit dem Bimsstein rieben passive männliche Homosexuelle sich die Haare an den Beinen ab und wirkten dadurch attraktiver.
Die Machart des Buches ist etwas zu laut, aber nehmt alles nur in allem: Lest das Buch, es ist gelehrt und zudem amüsant. Einen besonderen Applaus verdienen seine Prosaübersetzungen zahlreicher Gedichte. Ihr werdet einen neuen Catull kennenlernen und befriedigt ein originelles Buch aus der Hand legen.
KURT FLASCH
Niklas Holzberg: "Catull". Der Dichter und sein erotisches Werk. C. H. Beck Verlag, München 2002. 228 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Kurt Flasch, der Rezensent, ist ein wohlerzogener Herr aus gutbürgerlichen Verhältnissen und geheuer ist ihm nicht, das gibt er ein ums andere Mal zu, wie unverblümt der Autor des Buchs aufs Sexuelle zu sprechen kommt. Andererseits tut Holzberg, das räumt der Rezensent auch ein, es einfach dem Gegenstand nach, der es an Frivolität nicht fehlen lässt. Fachlich hat Flasch jedoch überhaupt nichts einzuwenden, er lobt die genauen Kenntnisse Holzbergs, der ungeahnte Verbindungen zu anderen AutorInnen (Sappho vor allem) herzustellen verstehe, überhaupt die Neuheit des Ansatzes, die Verständlichkeit von Sprache und Argumentation. Auch die von Holzberg vorgenommenen neuen Übersetzungen Catullscher Gedichte finden das uneingeschränkte Lob des Rezensenten. Nur, eben, die allzu explizite Rede von Penetrierenden und Penetrierten, die findet er ein wenig penetrant.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Zoten-Dichter aus Verona
Was wollte der Dichter uns damit sagen? Wohl jeder Lehrer nutzte die Chance, Schüler mit dieser Frage zu traktieren. Und was hat Catull, eigentlich Gaius Valerius Catullus, aus dem 1. Jahrhundert vor Christus hinterlassen? Der Mann aus Verona gehörte in seinen Jugendjahren in Rom zu einem Kreis von Poeten, für die die hellenistische Dichtung das Ideal, der Maßstab war. Erhalten blieben 120 Catull-Gedichte, deren zentrales Thema die Liebe ist. Die römische Geschlechterordnung beruhte auf dem Prinzip der Phallokratie. Sie war ein Abbild der Staatsordnung, dem patriarchalischen System verpflichtet, und sie stellte auch alles politische Handeln unter die Herrschaft mächtiger Männlichkeit. Es war dreckig auf
Was wollte der Dichter uns damit sagen? Wohl jeder Lehrer nutzte die Chance, Schüler mit dieser Frage zu traktieren. Und was hat Catull, eigentlich Gaius Valerius Catullus, aus dem 1. Jahrhundert vor Christus hinterlassen? Der Mann aus Verona gehörte in seinen Jugendjahren in Rom zu einem Kreis von Poeten, für die die hellenistische Dichtung das Ideal, der Maßstab war. Erhalten blieben 120 Catull-Gedichte, deren zentrales Thema die Liebe ist. Die römische Geschlechterordnung beruhte auf dem Prinzip der Phallokratie. Sie war ein Abbild der Staatsordnung, dem patriarchalischen System verpflichtet, und sie stellte auch alles politische Handeln unter die Herrschaft mächtiger Männlichkeit. Es war dreckig auf
Mehr anzeigen
Gassen, Straßen, und es ging heftig zu in Häusern und Bordellen. Sittenlosigkeit prägte diese vorchristliche Zeit. Und zotig, ja pornografisch dichtete Catull, was in den Schulbüchern jedoch nicht zu lesen war.
Klassiker stürzt vom Sockel
Niklas Holzberg, Professor für Klassische Philologie an der Universität München, will sich an eine breite Leserschaft wenden und holt nun den Dichter vom "Sockel des Klassikers herunter", auf den ihn die Philologie gehoben habe. Er zitiert die Gedichte in deutscher Übersetzung, verzichtet auf metrische Wiedergabe, um einen authentischen Eindruck vom Wortlaut des Originals zu vermitteln. Das sei gerade an obszönen Stellen notwendig, so der Autor. Denn Catull verwende Ausdrücke der Vulgärsprache, die man auch in pompejianischen Graffiti finde. Dazu gehöre - um eine Beispiel zu zitieren - "mentula", das nicht verniedlichend "Schwänzel" heiße, sondern ganz unverblümt "Schwanz". Doch auch die weniger deftigen Gedichte sind sicher für jeden ein Erlebnis, der sich für die klassische Antike und erotische Lyrik begeistert.
(Roland Große Holtforth, literaturtest.de)
Klassiker stürzt vom Sockel
Niklas Holzberg, Professor für Klassische Philologie an der Universität München, will sich an eine breite Leserschaft wenden und holt nun den Dichter vom "Sockel des Klassikers herunter", auf den ihn die Philologie gehoben habe. Er zitiert die Gedichte in deutscher Übersetzung, verzichtet auf metrische Wiedergabe, um einen authentischen Eindruck vom Wortlaut des Originals zu vermitteln. Das sei gerade an obszönen Stellen notwendig, so der Autor. Denn Catull verwende Ausdrücke der Vulgärsprache, die man auch in pompejianischen Graffiti finde. Dazu gehöre - um eine Beispiel zu zitieren - "mentula", das nicht verniedlichend "Schwänzel" heiße, sondern ganz unverblümt "Schwanz". Doch auch die weniger deftigen Gedichte sind sicher für jeden ein Erlebnis, der sich für die klassische Antike und erotische Lyrik begeistert.
(Roland Große Holtforth, literaturtest.de)
Schließen
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für