vertreiben, indem man die Gruft der Urgroßeltern öffnet.
Die aufkeimende Hoffnung, man könne die bürgerliche Kultur rezyklieren und mit ihrem Wertekanon die heutige Gesellschaft kurieren, nährt sich weniger von wiederbelebter Erinnerung als von fortgeschrittenem Vergessen. Die Spuren des historischen Bürgertums verschwinden, nun kann es zum Objekt nostalgischer Phantasie werden. Daher erstaunt es wenig, daß ein Buch über "Bürgerliche Werte um 1800" mit der Feststellung beginnt, es sei in der historischen Forschung "still geworden um das Bürgertum".
Tatsächlich steht der von Hans-Werner Hahn und Dieter Hein herausgegebene Band etwas erratisch in der Forschungslandschaft; er ist kein bloßer Nachzügler der ertragreichen Bürgertumsstudien aus dem zwanzigsten Jahrhundert und wohl auch kein Vorbote ihres neuerlichen Aufschwungs. Seine besten Beiträge deuten zwar an, daß die Zeit reif wäre für eine aus nüchterner Distanz geschriebene Kulturgeschichte des Bürgertums, andere veranschaulichen aber, was dem im Wege steht: Die Rückkehr zur "Bürgerlichkeit" dient auch an der unter Spardruck und Vermassung ächzenden Universität als utopischer Fluchtpunkt. Schon im Auftakt von Klaus Manger über die "großen Vier" der Weimarer Dichterwelt - Goethe, Schiller, Herder und Wieland - klingt eine bildungsbürgerliche Begeisterung an, die sich gerne im Labyrinth der gelehrten Quer- und Rückverweise verliert.
Geographisch ist das Buch auf den Raum Weimar-Jena, wo sich bürgerliche Wertebildung um 1800 in vielfältiger Weise bündelte, fokussiert, thematisch auf den Wechselbezug "zwischen sozialer Formation und Wertevermittlung". Dieser Ansatz verbindet eine regionale Perspektive mit einer umfassenden Fragestellung und eröffnet damit einen vertieften Einblick in die Beschaffenheit des bürgerlichen "Wertehimmels": Er ging aus einer singulären Konstellation hervor, war von Anbeginn widerstrebenden Kräften ausgesetzt, veränderte laufend sein Aussehen und verlor schon in der Jahrhundertmitte, mit der Industrialisierung, an Strahlkraft.
Der Band setzt mit Studien zu typischen "Werteproduzenten" wie Pfarrern (Martin Kessler), Professoren (Klaus Ries) und Wirtschaftskapitänen (Ralf Roth) ein; es folgen Aufsätze über Institutionen der Wertevermittlung, etwa Schulen (Leonhard Friedrich), Theaterbühnen (Frank Möller) und Zeitschriften (Werner Greiling); erst im dritten Teil werden einzelne Wertekomplexe wie Bildung (Michael Maurer), Arbeit, Fleiß und Ordnung (Dieter Hein) oder Selbständigkeit und Partizipation (Lothar Gall) beleuchtet; den Abschluß machen Abhandlungen über Rezipienten bürgerlicher Werte, darunter das Judentum (Simone Lässig) und der Adel (Ewald Frie).
Bei genauerem Hinsehen erweisen sich viele bürgerliche Leitwerte nicht als Neuschöpfungen, sondern als Umformungen älterer Konzepte kirchlichen oder adligen Ursprungs. Das bürgerliche Bildungsideal blieb in mancher Hinsicht, wie Michael Maurer betont, der adligen Standesbildung verpflichtet, obwohl es sich von dieser mit den Geboten der Zweckfreiheit, Universalität und Individualität ostentativ abwandte: Man postulierte Bildung als Allgemeingut und praktizierte sie als Statussymbol. An diesem Widerspruch mußte die bürgerliche Bildung zerbrechen, sobald die Massen in ihre Sphären vorstießen. Für Maurer zeichnet sich ihr Ende schon in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ab.
Das bürgerliche Familienideal wies dagegen einen starken religiösen Unterbau auf. Andreas Gestrich hebt für Deutschland den Einfluß des Pietismus hervor. Habe die religiöse Unterweisung außerhalb der Kirche schon durch die Reformation einen höheren Stellenwert erhalten, so sei sie im Pietismus auf den häuslichen Bereich zentriert worden. Abgeschottet von der bösen Welt, wurde die Familie zum Hort der inneren Einkehr und erhofften Bekehrung. In dieser "geistlichen Kaserne" galt es, die Seele des Kindes durch repetitive erzieherische Maßnahmen gegen die Versuchungen der Welt zu stählen. Es lag damit wesentlich in den Händen der Eltern, wie ihre Kinder herauskamen. Daran knüpfte die bürgerliche Pädagogik an, lastete den Eltern aber eine noch größere Verantwortung auf, indem sie die Trennung von Familie und Welt aufrechterhielt, die Erbsünde jedoch eliminierte.
Institutionen der bürgerlichen Wertevermittlung griffen die Ständeschranken selten offen an, sondern untergruben sie diskret. Gerhard Müller veranschaulicht dies an einem Übergangsphänomen, das im Schatten der Aufklärung gedieh: der Freimaurerei. Ihre wechselvolle Geschichte schildert er von der Gründung der Jenaer Loge "Zu den drei Rosen" 1744 bis zum Übergang ihrer berühmten Weimarer Nachfolgerin "Amalia" ins bürgerliche Vereinsleben nach 1844. Dabei wird ersichtlich, daß gerade die hybride Kreuzung aus Esoterik und Rationalität Adligen, Stadtbürgern, Staatsbeamten und Literaten ein gemeinsames Dach bot und sie aus den Hierarchien des Alltags löste.
Der Band eignet sich sowohl für eine Einführung in die Geschichte der bürgerlichen Kultur als auch für ihr vertieftes Studium. In beiden Fällen fördert er die Einsicht in die Historizität des Bürgerlichen und kann im besten Fall dazu beitragen, daß man für die gegenwärtigen Probleme andere Lösungen sucht, als die Vergangenheit zur Zukunft zu machen.
CHRISTOPH HIRSCHI
Hans-Werner Hahn und Dieter Hein (Hrsg.): "Bürgerliche Werte um 1800". Entwurf - Vermittlung - Rezeption. Böhlau Verlag, Wien 2006. 420 S., geb., 44,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
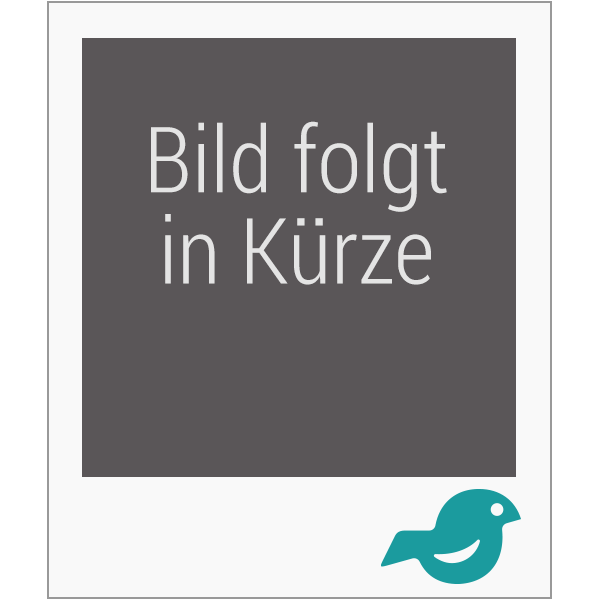




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.04.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.04.2006