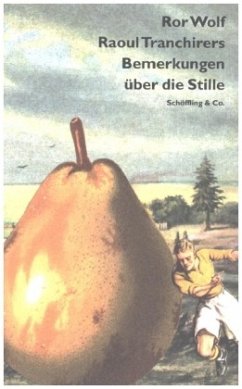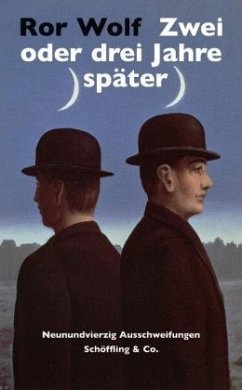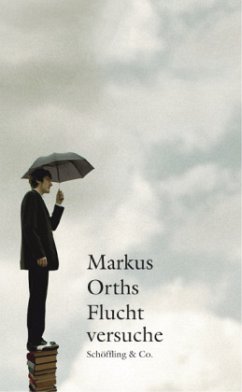Tanzvergnügen. Im Gegenzug - Parodie hin oder her - steht da ein Dichter, sensibel, subversiv. Hinter Bube, Dame, König plötzlich ein As.
Auch achthundert Jahre später läßt sich Bauernhaß kultivieren. Die aus Hamburg stammende, bei Lübeck aufgewachsene und in Berlin gestrandete Schriftstellerin Svenja Leiber hat ihn zum Leitthema ihres ersten Erzählungsbandes "Büchsenlicht" erkoren, und - potz Blitz! - er trägt noch immer. Dafür verantwortlich ist in erster Linie Leibers glänzender Erzählstil, souverän, punktgenau, urkomisch (Betonung auf "ur"), mitunter kokett: "Im Sommer saß ich mit meinen Brüdern auf dem Rinnstein, wir klappten die Füße im Straßendreck hin und her wie Scheibenwischer, und mein Bruder schrieb ,Jenke ist ein Dummsack' in den Sand. Der alte Jenke war wirklich etwas dumm. ,Das kommt von den Lösungsmitteln', sagte meine Mutter. Der alte Jenke war Maler. Mir sagte das Wort ,Lösungsmittel' nichts, aber ein Dummsack war er."
Die meisten Erzählungen in "Büchsenlicht" basieren auf der Spannung zwischen den Mentalitäten, denn allenthalben geraten zarte, verletzliche Geschöpfe ins bäurisch-maskuline Milieu hinein, Frauen, Kinder, Homosexuelle, Musiker, nackt unter Wölfen. Die Autorin verhehlt nicht, auf wessen Seite sie steht. Hörbar atmet sie auf, als Sohn Holger den monströs gewalttätigen Vater erschlägt: ",Mittenrein', sagte er leise." Mittenrein in die Rustikaltristesse schleicht sich die Autorin, zu den Käuzen in die Ställe, in die guten Stuben unter den Eternitdächern. Das Dekor ist stimmig: Tagetes wächst in jedem Staudenbeet, "Haribo und Daim" machen in Schälchen die Runde, und verschenkt wird ausschließlich Likör.
Radikal ist Leibers Verachtung, weil sie lakonisch daherkommt. Das rurale Gesinde ist hier jenem Rest von Bauernschläue abhold, den Neidhart seinen Akteuren noch zugestand. Ödnis herrscht in "Büchsenlicht", leere Rituale, unbeherrschte Aggressionen und die Verzweiflung der Außenseiter. Seltsam nah rücken dabei Gegenwart und Vergangenheit zusammen: "Die Altbauern dagegen hatten alle ein paar Seelen auf dem Gewissen. Hatten die Polen in die kleinsten Ställe gesperrt, hatten sie hungern lassen, und der Müller hatte seinen sogar aufgehängt, nachdem er ihn an einer Leine durch den Ort gepeitscht hatte." Leiber schreibt mit dem Stilett, seziert die lautstark schweigende Kommune.
Eine der stärksten Erzählungen, "Eckeneckepen", die der Autorin vor zwei Jahren den "Literaturpreis Prenzlauer Berg" einbrachte, bildet den fulminanten Auftakt des Buches. Fast immer nämlich fügen sich ihre zarten Figuren, wenn sie die Dörper nicht einfach ignorieren, wie es die Jugendlichen am Glascontainer tun, in ihre Rolle als Beutestück. So die Freundin des Jägersohns oder Jula mit ihren aufgeschlitzten Armen, die alles zu geben bereit ist, um den edelsten Rappen reiten zu dürfen. In "Eckeneckepen" aber schlägt das Unterdrückte zurück, Häuser und Bauern stehen in Flammen. Mag Leibers Prosa über Strecken an Thomas Bernhards Zynismus oder an Arnold Stadlers Melancholie erinnern, am Rachepol glüht eine kaum erklärbare Wut auf: So hat nicht einmal Adorno 1944 an Deutschland gedacht. Und um Deutschland geht es: "Wieviel Erde brauchen die Deutschen?" Antwort: "So viel, daß sie dort all den Schrott draufstellen können, den sie sich im Baumarkt kaufen." Svenja Leiber schreibt an gegen einen internalisierten Heidegger, gegen die Aufrichtung der Ästhetik an van Goghs Bauernstiefeln, was zwangsläufig zur Anhimmelung der Wahrheit des Seienden führt. Vom Seienden, das sich die Deutschen im Baumarkt holen, gibt es längst viel zuviel.
Sorgfältig ist die Geschichte "Raschpichler" komponiert, in der sich Leichenschmaus und Hochzeitsfeier überlagern, was zu einem Neidhartschen Bauerngetümmel im "Feldkrug" führt: "Die Wölfe und die Füchse, die Ochsen und die Eber grölten." Die Identifikationsfigur, Heide Raschpichler, die es auf Hans Daleckie - "der einzige im Dorf, bei welchem ihr kein Tier einfiel" - abgesehen hatte, ehelicht aufgrund eines Mißverständnisses einen anderen Hans, eines der Tiere, aber sie vollbringt es, in derselben Nacht einen "Menschensohn" zu empfangen. Solche kleinen Siege, nicht der Defätismus, bilden das Zentrum von Leibers Fiktionen. Dabei sind nicht alle Erzählungen von derselben Qualität. Gegen Ende des Buches erinnert manches an Fingerübungen in der Literaturwerkstatt. Aber Svenja Leiber bekommt doch den Bogen. In der letzten Erzählung tritt Bauer Heinrich mit Getöse ab, dafür taucht ein geheimnisvoll kommunistischer Onkel, das ganz andere, auf: "Tommsen liebte die Freiheit, und alle liebten ihn. Er roch und sprach so anders." Die Zukunft des sechsjährigen "Mädchens" ist immerhin ungewiß: "Das Mädchen wollte einmal so werden wie er."
Offen bleibt auch die Parodiefrage. Wo Neidhart Bauer sagte, meinte er schließlich Ritter. Wen aber hat die Autorin tatsächlich im Visier? Die Ackersleute vom Prenzlauer Berg? Wer auch immer es sei, er möge seinen Kittel fest verschnüren. Denn nachgeben wird Svenja Leiber nicht. Wenn sie eine Sache hochgereckten Näschens mißachtet, dann die altteutsche Vorsichtsmaßnahme: "Sachte ins dorff, die pawern seind trunken!"
Svenja Leiber: "Büchsenlicht". Erzählungen. Ammann Verlag, Zürich 2005. 154 S., geb., 17,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
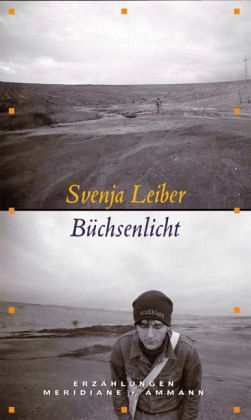




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.03.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.03.2005