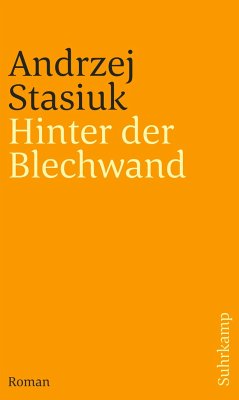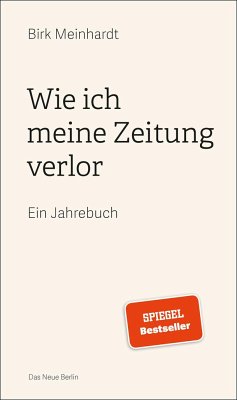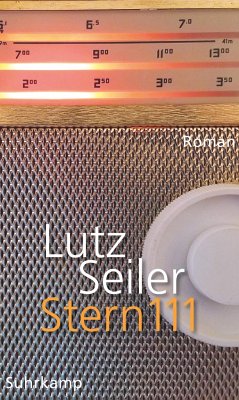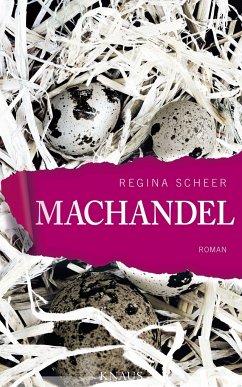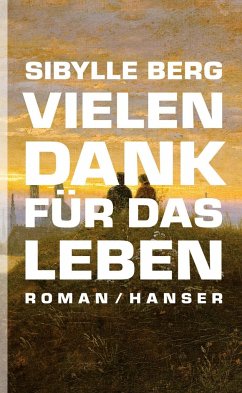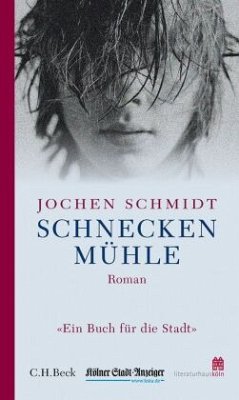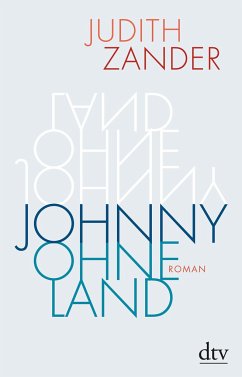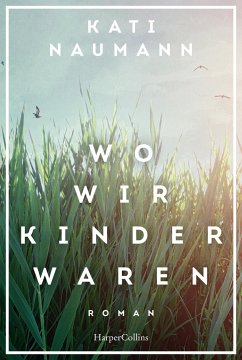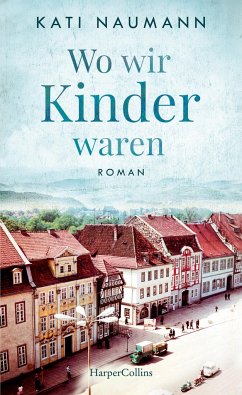Familie Werchow fortsetzt, verweigert sich nicht nur, was den großzügig bemessenen Umfang von beinahe 700 Seiten angeht, jedweder Effizienz. Geschwätzigkeit ist ein Vorwurf, der bereits dem ersten, ähnlich umfangreichen Band der "Brüder und Schwestern" gemacht wurde, der über die Jahre 1973 bis 1989 erzählt. Unbeeindruckt von dem historischen Umbruch, jedenfalls in ästhetischer Hinsicht, schwätzt Meinhardt nun munter weiter.
Mit viel gutem Willen könnte man mithin Meinhardts ausufernden, dabei allerdings nie verführerisch barocken oder gar lustvollen, sprachlich weder ausgefeilten noch artifiziellen, stattdessen behäbigen und dadurch nicht zuletzt allenfalls haarscharf an der Selbstgefälligkeit vorbeischrammenden Stil als bewusstes Gegenprogramm sowohl zu den vermeintlichen Forderungen der Gegenwart als auch zu ästhetischer Avanciertheit verstehen. Was allerdings ausbleibt, ist der erhellende Funke, der sich daraus womöglich schlagen ließe. Im Gegenteil, Meinhardt reproduziert kaum mehr als Nachwendeklischees. Hier heißt das: Die Gesetze des Marktes bestimmen nun die beruflichen Geschicke der Figuren und diffundieren bis auf die zwischenmenschliche Ebene.
Matti, der vormals systemkritische, widerspenstige der beiden Werchow-Brüder, Lastkahnschiffer und Schriftsteller, muss mitansehen, wie sein unmittelbar vor dem Mauerfall im Westen publizierter Roman verpufft, stattdessen macht er einen Reibach mit einem Kinderbuch über Wolken. Den Geldsegen kann er dazu nutzen, den ausgedienten Lastkahn in ein Restaurant umbauen zu lassen. Darauf, dass Catherine, seine Jugendliebe und mittlerweile Ehefrau und Mutter des gemeinsamen Sohnes, das Geld ebenfalls gern für die Einrichtung einer eigene Arztpraxis verwendet hätte, kann er leider keine Rücksicht nehmen. Selbstverwirklichung heißt das Gebot der Stunde, jedenfalls seiner, weshalb Matti sich zudem relativ umgehend eine Geliebte gestattet. Das Restaurant-Schiff liegt derweil vertäut in Berlin-Köpenick, am Ufer marode Fabrikanlagen, zu erreichen nur über mit Gestrüpp zugewucherte Matschpfade - beste Voraussetzungen, um das alte Schiff binnen kürzester Zeit zum florierenden Geheimtipp unter Westlern zu machen, die den exotischen Osten bestaunen wollen.
Mattis Kompagnon Peter, dessen Herz ganz sicher am berühmten rechten Fleck sitzen mag, der aber in seinem betulichen Dauergequatsche im Ost-Berliner Dialekt eine veritable Nervensäge ist, serviert Ost-Hausmannskost, vor allem seine sagenhaften Sauren Eier, eine gräulich-trübe Pampe, die bei den auf den Schein von Äußerlichkeiten getrimmten Gästen zunächst Naserümpfen, nach dem ersten Bissen aber Entzücken hervorruft. Dass allerdings die Phase, während der die Exotik und das Provisorische des Ostens gefeiert wurden, eine vorübergehende war, deren Ende oftmals sehr unschöne Züge annahm, zeigt sich auch bei Meinhardt: Die Gentrifizierung hat bald auch das Köpenicker Ufer erreicht, Luxuswohnungen mit dazugehörigem Bootsanleger sollen geschaffen werden. Als Matti und Peter sich weigern, mit ihrem Kahn das Feld zu räumen, kommt es zur Katastrophe.
Kaum überraschend, dass auch Mattis stets opportunistischer Bruder Erik sich mittlerweile ohne viel Federlesens mit den neuen Gegebenheiten arrangiert hat. Eriks Anstellung im Marketing eines Pharmakonzerns nutzt Meinhardt, um sich über die fraglos albernen Teambildungsmaßnahmen solcher Unternehmen zu mokieren und die Praktiken des Westens in satirischer Überzeichnung offenzulegen: Auf dem Markt gebracht werden soll ein gewinnversprechendes Medikament. Anwendungsgebiet: der angeblich pathologische Zwang, ohne Vorwarnung die eigene Familie zu verlassen.
Zudem, und das ist nun wirklich nah am Groschenroman, wird durch Eriks neuen Job auch noch ein Familiengeheimnis der Werchows gelüftet: Eriks Vorgesetzte - Typ harte Managerin mit übersteigert männlicher Attitüde und gegelten Haaren - entpuppt sich als uneheliche Tochter des bereits verstorbenen Vaters Willy, eine Tatsache, die vor den drei offiziellen Kindern verschwiegen und von Ehefrau Ruth still leidend mitgetragen wurde, über beider Tod hinaus.
Ach, überhaupt, das Frauenbild, das das weibliche Personal von Meinhardt zu verkörpern gezwungen ist, kann wohl nur mit der Antiquiertheit entschuldigt werden, die diesen Roman insgesamt auszeichnet. Die Frauen sind Opfer der Verhältnisse. Wo sie nicht verhärten wie die verleugnete Tochter, leiden sie stumm vor sich hin oder werden betrogen, wenn sie, wie Catherine, am Gatten zu mäkeln beginnen. Und wenn der Betrug schließlich auffliegt, fliehen sie allenfalls unter das Dach der eigenen Mutter, nicht ohne am Ende dem reumütigen Gatten doch wieder die Schlafzimmertür zu öffnen.
Oder aber sie stolpern naiv durch die Welt, wie Britta, die Schwester Mattis und Eriks, der als Tuchakrobatin freilich ohnehin der Sinn für die prosaischen Notwendigkeiten des Alltags fehlt. Ihr Zirkus macht nach der Wende Bankrott, und sie wird mit der bitteren Einsicht konfrontiert, dass ihre im Osten avancierte Tuchnummer im Westen nicht gefragt ist, stattdessen fällt sie aufs denkbar dümmlichste windige Investmentversprechen herein und verschuldet sich und ihre Brüder gleich für die nächsten Jahre. Auch Britta flieht daraufhin zunächst, wie Catherine, von Berlin ins Thüringische und verkriecht sich dort im noch nicht verkauften Haus der verstorbenen Eltern. Aber immerhin hat Meinhardt für die strauchelnde Tuchakrobatin schlussendlich Rettung: einen erfolgreichen, attraktiven und auch noch gutherzigen Mann, an dessen starker Schulter sie Schutz vor dem kalten Wind der Wirklichkeit findet.
Selbst als Vorlage für einen ZDF-Mehrteiler trüge dieser Roman nur, wenn mindestens Henry Hübchen als Pausenclown aus der Zubereitung der Sauren Eier ein so famos komisches Massaker macht, wie er das dereinst unter Castorf mit seinen legendären Kartoffelsalat-Nummern veranstaltet hat. Andernfalls reichte es nur zu trüber Soße aus zu spät gekommenem sozialistischem Realismus mit Nostalgie-Einlage.
WIEBKE POROMBKA
Birk Meinhardt: "Brüder und Schwestern". Die Jahre 1989-2001. Roman.
Hanser Verlag, München 2017. 672 S., geb., 26,- [Euro]
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
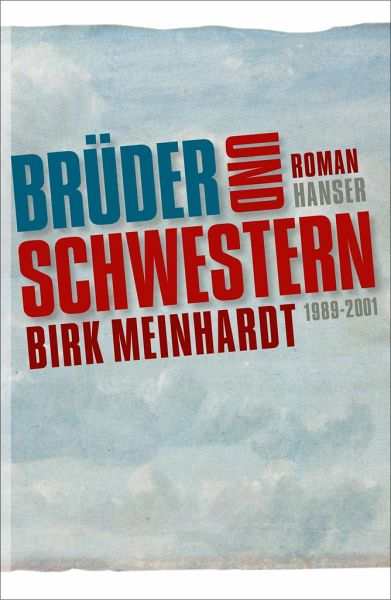





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.06.2017
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.06.2017