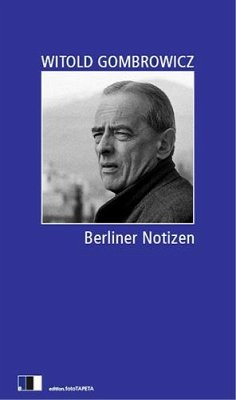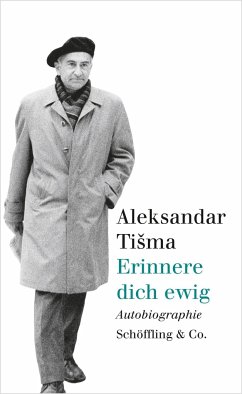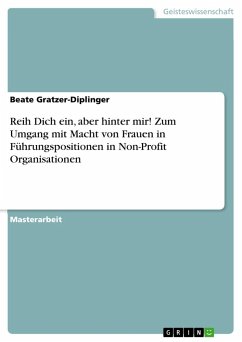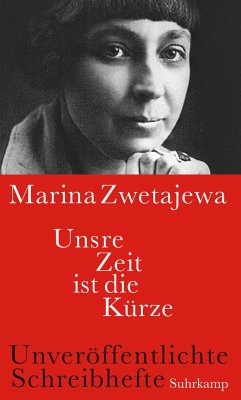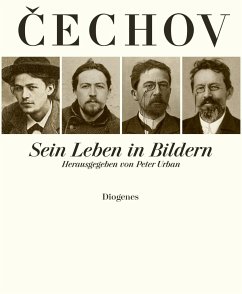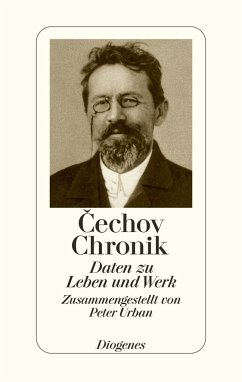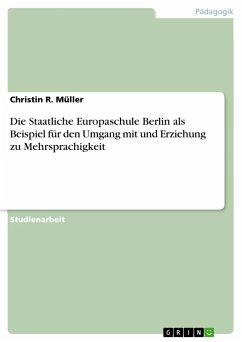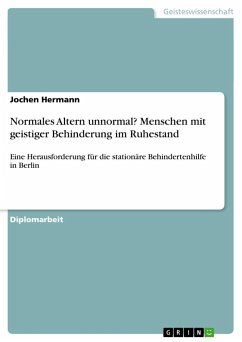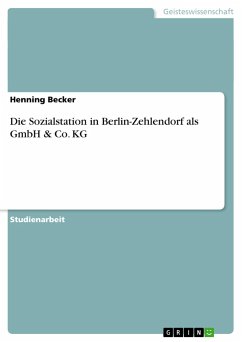schenkt, für eine Erinnerung nutzen würde, die sie sechzig Jahre zurückführt.
In den "Briefen an Dich" ist das gegenwärtige Leid immer der Ausgangspunkt für eine Reise in die Vergangenheit, deren Ereignisreichtum in groteskem Gegensatz zur Monotonie der Liebeslitanei steht. Vera Lourié wurde 1901 in Sankt Petersburg geboren und erlebte eine wohlbehütete, etwas eingeengte Kindheit in reichem Haus. Nach der Revolution emigrierte sie 1921 mit ihrer Familie nach Deutschland und verbrachte ihr gesamtes Leben in Berlin, wo sie, völlig verarmt, 1998 starb.
"Erinnerungen an das russische Berlin" lautet denn auch der Untertitel ihrer nun erschienenen Briefe, von der Journalistin und Slawistin Doris Liebermann sorgsam ediert. Liebermann hatte Lourié schon in den achtziger Jahren ein paar Mal besucht und interviewt. Als Zeitzeugin entdeckt worden war Lourié aber schon zuvor von dem amerikanischen Slawisten Thomas R. Beyer, der das 1987 veröffentlichte Überblickswerk "Russische Autoren und Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg" mitherausgegeben hat.
Über diese Entdeckung hat sich Lourié zweifelsohne gefreut, und man darf annehmen, dass das späte Interesse einen entscheidenden Anteil an dem Entschluss hatte, ihre Erinnerungen doch noch zu Papier zu bringen. Interessanter als ihre eigenen schriftstellerischen Arbeiten, von denen einige kürzere Texte dem Band hinzugefügt wurden, sind tatsächlich die Anekdoten, die sie aus ihrer Zeit als junge Frau in Berlin zu berichten weiß: Mit dem russischen Symbolisten Andrej Belyj etwa tanzte sie in einem Café am Viktoria-Luise-Platz "zu den Rhythmen von One-Step und Shimmy einen von ihm selbst erfundenen Tanz, der nicht die geringste Ähnlichkeit mit den Modetänzen hatte, das Publikum aber so begeisterte, dass ich Blumen geschenkt bekam".
In der großen Gemeinde russischer Emigranten traf sie zudem mit dem Schriftsteller Ilja Ehrenburg, dem Kunstsammler Lasar Mejerson und dem Maler Iwan Puni zusammen, der, wie Lourié schreibt, "obgleich verheiratet, wenig Interesse an Frauen" hatte. Diese letzte, lapidare Bemerkung ist indes nicht nur wegen des Stils typisch für Lourié. Es fällt überhaupt auf, dass sie sich weit weniger an die inhaltlichen Debatten der russischen Bohème jener Tage erinnert, umso mehr aber daran, wer mit wem gerade welchen Ehepartner betrog. Da überrascht es nicht, dass sie ausführlich von ihrer Liaison mit dem russisch-jüdischen Rechtsanwalt Alexander Posnjakow berichtet. Erstaunlich ist gleichwohl, mit welcher Naivität sie auf die Umstände seines Todes blickt. Denn Posnjakow war mit einer Deutschen verheiratet, die ihren Mann wiederum mit einem anderen hinterging.
Als Lourié sich von Posnjakow einmal schlecht behandelt fühlte, erzählte sie ihm davon. In der Folge stritten und trennten sich die Eheleute, und die verärgerte Gattin verriet ihren Mann, der einen falschen luxemburgischen Pass besaß, bei der Gestapo. "Meine Rache war gemein", schreibt Lourié nun, "und ich trage teilweise die Schuld daran, dass Posnjakow später im KZ Dachau umgebracht wurde." Nicht nur an dieser Begebenheit lässt sich beobachten, wie Louriés Lakonie immer stärker in eine geradezu ärgerliche Ignoranz kippt, je mehr sie sich zeitlich dem Nationalsozialismus nähert. Als Halbjüdin - ihre Mutter war jüdischer Herkunft und überlebte das KZ Theresienstadt - gelang es ihr, den Krieg in Berlin unbeschadet zu überstehen. Auch nach der Kapitulation, als russische Soldaten in den Luftschutzkeller ihres Hauses traten und sie, weil sie Russisch sprach, von den Nachbarn nach vorne geschoben wurde, konnte sie an den Soldaten vorbei in ihre Wohnung zurückkehren. Das aber, was danach in dem Keller geschah, beschreibt sie nur mit einem einzigen Satz: "Ich nahm die schwangere Hauswartsfrau und ihren dreijährigen Sohn mit hinauf. Im Keller fanden Massenvergewaltigungen statt."
Schließlich verleitet sie ihre (gefährliche) Tätigkeit als Schwarzhändlerin von Lebensmitteln, mit der sie sich nach dem Krieg über Wasser hielt, zu der Einschätzung: "Es ging uns wirklich gut. Ich war dick und rund, eine richtige Reklame für die Besatzer." Dass es anderen weniger gut erging, ist ihr zwar durchaus bekannt. Und Lourié spart auch nicht mit Beschreibungen des um sie herum herrschenden Elends. Reflexionen aber über das schlechthin Unwahrscheinliche ihres eigenen Glücks vermag dieses Wissen nirgends in Gang zu setzen. Das eigene Überleben und die körperlich-seelische Unversehrtheit als Frau werden von ihr auch nach Jahrzehnten als schöne Tatsachen hingenommen - und weiter beschwiegen.
Man liest und staunt: Wie kann eine Frau, deren Leben so verknüpft war mit den Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts, so frei von jedem relativierenden Zweifel über dieses Leben schreiben? Denn das tut sie: Vera Lourié erzählt ihre Geschichte, als wäre sie ein Roman. Und genau darin, in der krassen Diskrepanz zwischen Erzählhaltung und Geschehen, liegt die wahre Wirkkraft dieses Buchs. Es ist gespenstisch.
LENA BOPP.
Vera Lourié: "Briefe an Dich". Erinnerungen an das russische Berlin.
Hrsg. von Doris Liebermann. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2014. 261 S., geb., 22.95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
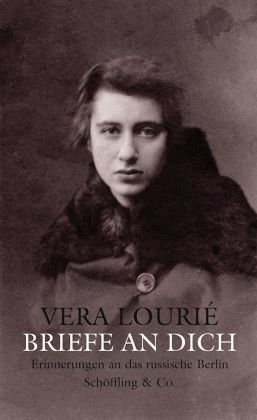





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.07.2014
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.07.2014