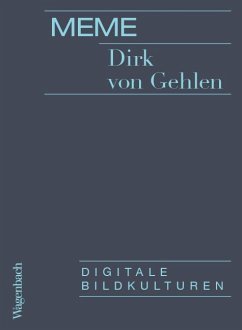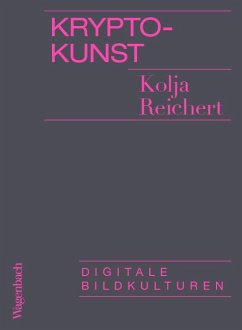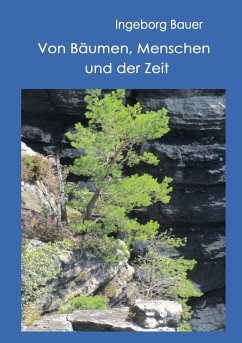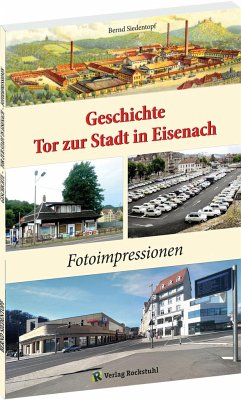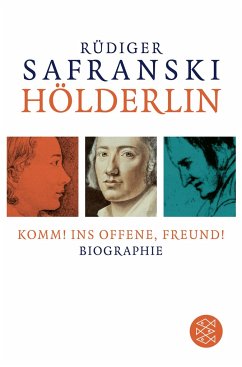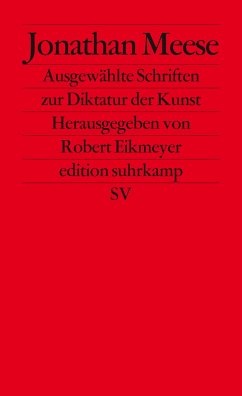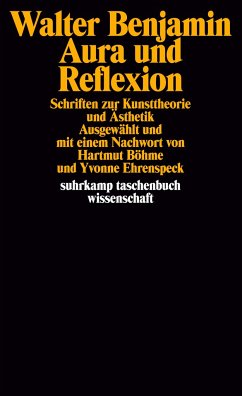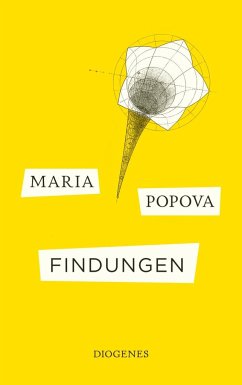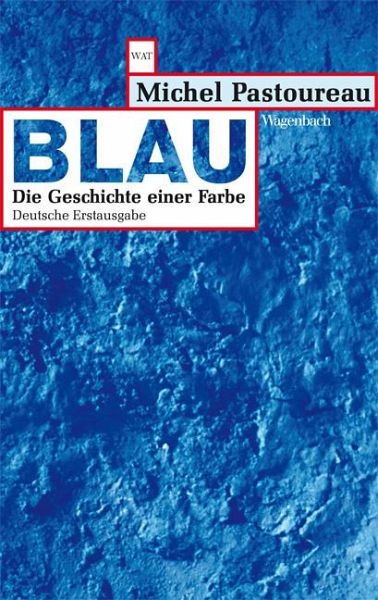
Blau
Die Geschichte einer Farbe
Übersetzung: Gittinger, Antoinette
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
13,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Es ist nicht der Künstler, der eine Farbe prägt, sondern die Gesellschaft, diesie rezipiert. So unterliegt der Symbolgehalt des Blau einer sehr wechselvollenGeschichte von der Antike bis heute. Jahrhundertelang fristete es ein Nischendasein.In der römischen Antike zählten nur Weiß, Schwarz und Rot. Erst mitdem Marienkult im 11. Jahrhundert wird das Blau wichtiger Bestandteil derklerikalen und dann auch der politischen Ikonographie. Als Kennzeichen derGottesmutter und des Königs, später auch von Soldaten wird es zum neuenKonkurrenten des Rot.Pastoureau folgt den Spuren des Blau auf seine...
Es ist nicht der Künstler, der eine Farbe prägt, sondern die Gesellschaft, diesie rezipiert. So unterliegt der Symbolgehalt des Blau einer sehr wechselvollenGeschichte von der Antike bis heute. Jahrhundertelang fristete es ein Nischendasein.In der römischen Antike zählten nur Weiß, Schwarz und Rot. Erst mitdem Marienkult im 11. Jahrhundert wird das Blau wichtiger Bestandteil derklerikalen und dann auch der politischen Ikonographie. Als Kennzeichen derGottesmutter und des Königs, später auch von Soldaten wird es zum neuenKonkurrenten des Rot.Pastoureau folgt den Spuren des Blau auf seinen verschlungenen Wegen nichtnur in Bildzeugnissen, sondern auch in zahlreichen Beschreibungen in literarischenund wissenschaftlichen Texten, bei Goethe sogar in doppelter Hinsichtmit seiner Farbenlehre und dem Werther. Farben wurden dabei oft bestimmteEigenschaften zugeschrieben, auch moralische. Nicht zufällig ist das Signet derEU ebenso blau wie das der UNO. Der Autor beschreibt schließlich auch dasHandwerk des Färbens, das den blauen Triumphzug überhaupt erst möglichmachte und der Palette des Blau zu einem enormen Variantenreichtum verhalf.