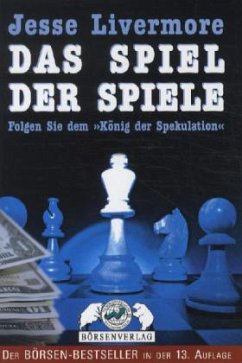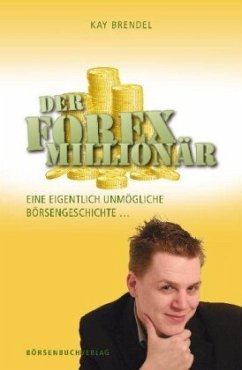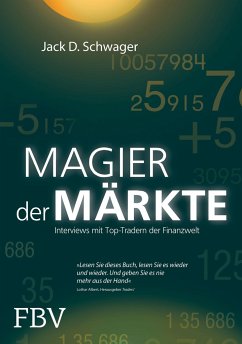Nicht lieferbar
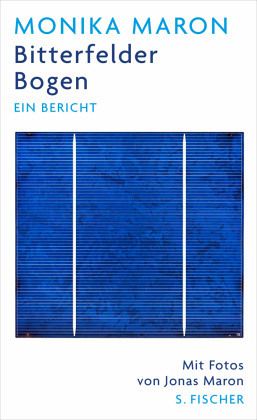
Bitterfelder Bogen
Ein Bericht
Fotos: Maron, Jonas
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
»Vielleicht kennen ja sogar die Ostdeutschen ihre eigenen Erfolgsgeschichten zu wenig, um stolz auf sie und sich selbst zu sein.«»B. ist die schmutzigste Stadt Europas«, schrieb Monika Maron in ihrem Debütroman 'Flugasche' (1981). B. steht für Bitterfeld, bis heute ein Synonym für marode Wirtschaft und verkommene Umwelt. Dreißig Jahre später hat sie die Stadt wieder besucht und die Spur der Veränderungen nachgezeichnet. Sie erzählt von der Wiederauferstehung einer Region, vor allem aber vom Aufbruch einiger Kreuzberger Solarenthusiasten in die Provinz Sachsen-Anhalts, wo sie eine So...
»Vielleicht kennen ja sogar die Ostdeutschen ihre eigenen Erfolgsgeschichten zu wenig, um stolz auf sie und sich selbst zu sein.«
»B. ist die schmutzigste Stadt Europas«, schrieb Monika Maron in ihrem Debütroman 'Flugasche' (1981). B. steht für Bitterfeld, bis heute ein Synonym für marode Wirtschaft und verkommene Umwelt. Dreißig Jahre später hat sie die Stadt wieder besucht und die Spur der Veränderungen nachgezeichnet. Sie erzählt von der Wiederauferstehung einer Region, vor allem aber vom Aufbruch einiger Kreuzberger Solarenthusiasten in die Provinz Sachsen-Anhalts, wo sie eine Solarzellenfabrik mit 40 Arbeitsplätzen bauen wollten. Nur acht Jahre später ist Q-Cells der größte Solarzellenhersteller der Welt. Aus der kleinen Solarzellenfabrik ist 'Solar Valley' geworden.
»B. ist die schmutzigste Stadt Europas«, schrieb Monika Maron in ihrem Debütroman 'Flugasche' (1981). B. steht für Bitterfeld, bis heute ein Synonym für marode Wirtschaft und verkommene Umwelt. Dreißig Jahre später hat sie die Stadt wieder besucht und die Spur der Veränderungen nachgezeichnet. Sie erzählt von der Wiederauferstehung einer Region, vor allem aber vom Aufbruch einiger Kreuzberger Solarenthusiasten in die Provinz Sachsen-Anhalts, wo sie eine Solarzellenfabrik mit 40 Arbeitsplätzen bauen wollten. Nur acht Jahre später ist Q-Cells der größte Solarzellenhersteller der Welt. Aus der kleinen Solarzellenfabrik ist 'Solar Valley' geworden.