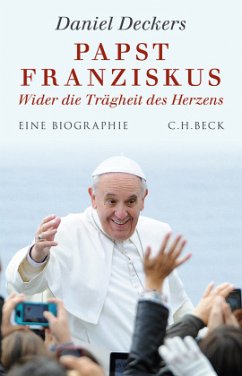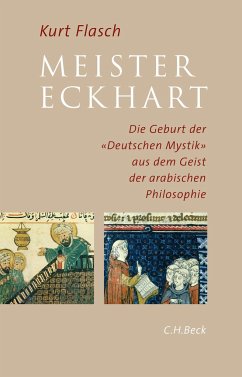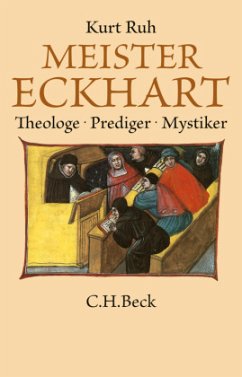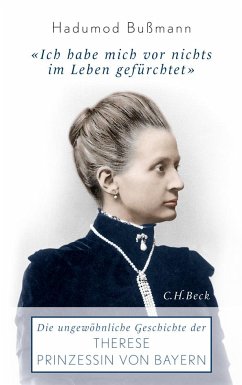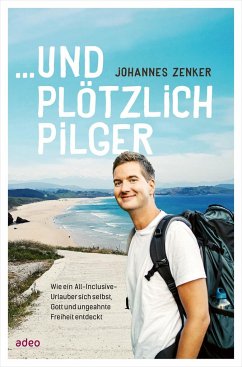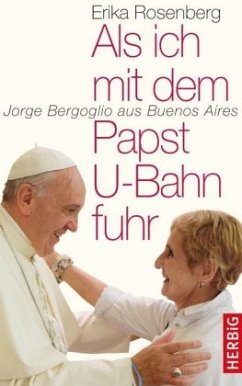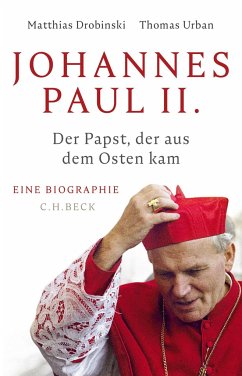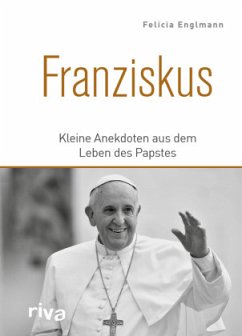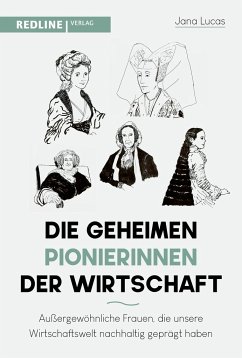Benedikt von Nursia die beiden Missionare Südosteuropas, Kyrill und Method, zu Beschützern und Vorbildern der Menschen im alten Kontinent gemacht hatte. Europäische Christen der Gegenwart seien aufgerufen, jene lange Geschichte der Heiligkeit fortzuführen, welche die verschiedenen Regionen Europas im Laufe von zwei Jahrtausenden durchzogen habe. Bis auf Teresia Benedicta a Cruce, also die schlesische Ordensfrau Edith Stein, die Märtyrerin der Nazizeit, gehören alle vom Papst privilegierten Heiligen dem Mittelalter an, jener Epoche, in der sich nach den Worten des römischen Pontifex "das Christentum als Religion der Europäer durchgesetzt" habe.
Birgitta und Katharina waren Zeitgenossinnen des vierzehnten Jahrhunderts; charismatisch begabt und im Sprachgestus alttestamentlicher Propheten wandten sie sich nach Visionen unter Gottes, Marias oder der Heiligen Weisung tadelnd und mahnend an Klerus und Laien einer Kirche im Niedergang. Beide litten an der Loslösung des Papsttums von Rom, das sich im provençalischen Avignon auf Dauer in der Art eines modernen Fiskalstaates mit höfischer Prunkentfaltung von seiner heilsgeschichtlichen Sendung zu entfernen schien. Abgesehen von einer Fahrt nach Avignon, blieb die sienesische Handwerkertochter allerdings im wesentlichen auf ihre Heimatstadt beschränkt und wirkte vor allem durch Hunderte von Briefen an Könige, Fürsten und Päpste; Birgitta hingegen verband auf ihrem Lebensweg Europas Norden mit Rom, ja mit den heiligen Stätten in Jerusalem und Bethlehem, und erreichte bis zur Gegenwart unzählige Christen durch ihre siebenhundert "Offenbarungen".
Für Johannes Paul waren es das Itinerar Birgittas und ihre Eignung als "ökumenisches Band" zu den skandinavischen Ländern, die sich in der Reformation "aus der vollen Gemeinschaft mit dem Römischen Stuhl losgelöst hatten", die die Heilige Schwedens zu einer der Patroninnen Europas prädestinierten. Birgitta war 1303 in Uppland zur Welt gekommen, Tochter eines Elternpaares aus den höchsten Kreisen, und schon als Vierzehnjährige mit einem Mann gleichen Standes vermählt worden. Diesem gebar sie acht Kinder - eine Ausnahme in der Reihe der großen Mystikerinnen des Mittelalters -, von denen eines später selbst als Heilige verehrt wurde.
Trotz hoher weltlicher Ämter war auch Birgittas Mann fromm und trat kurz vor seinem Tod in ein Zisterzienserkloster ein. Die gerade vierzigjährige Witwe erfuhr nun ihre Berufung zur Braut Christi und zum Sprachrohr Gottes: "Fürchte Dich nicht, denn ich bin der Schöpfer aller Dinge, aber kein Betrüger", so begegnete ihr Christus. "Wisse, daß ich nicht um Deinetwegen allein rede, sondern auch zum Heile aller Christen. Vernimm also, was ich Dir sage. Du wirst meine Braut und mein Kanal sein, Du wirst Geistliches und geheimes Himmlisches hören und sehen, und mein Geist wird bei Dir bleiben bis zu Deinem Tode." In einer anderen Relevacio schilderte Birgitta, die achtfache Mutter, geradezu die mystische Geburt Christi in ihr selbst. An einem Weihnachtsfest sei ihr die Mutter Gottes erschienen und habe zu ihr gesagt: "Meine Tochter, Du wunderst Dich über die Bewegung, welche Du in Deinem Herzen spürst. Fürchte keine Täuschung, sondern freue Dich, weil diese Bewegung, welche Du fühlst, das Zeichen der Ankunft meines Sohnes in Deinem Herzen ist. Wie deshalb mein Sohn Dir den Namen seiner neuen Braut beigelegt hat, so nenne auch ich Dich jetzt die Braut meines Sohnes. Diese Bewegung Deines Herzens aber wird in Dir bleiben und nach der Empfänglichkeit Deines Herzens gemehrt werden." Der Glaube an die Botschaft der mystischen Vereinigung mit Christus hat Birgitta die unerschütterliche Gewißheit gegeben, in jeder Lebenslage in Gottes Auftrag und nach Gottes Anweisung tätig werden zu müssen.
Vor allem plante sie den Aufbau eines neuen Ordens, der aus Frauen- und Männerklöstern bestehen, aber von Äbtissinnen geleitet werden sollte. Um die Approbation ihrer Ordensregel zu erwirken, begab sie sich zum Heiligen Jahr 1350 nach Rom und Italien, wo sie - abgesehen von einer Pilgerfahrt ins Heilige Land - bis zu ihrem Lebensende 1373 blieb. Der Birgittinerorden blühte aber erst jetzt auf und verbreitete sich über Skandinavien, das Baltikum, England, Italien, Bayern, das Rheinland und die Niederlande, anfangs entscheidend gefördert durch ihre Tochter, die heilige Katharina, sowie durch ihre Beichtväter. Diese bemühten sich auch um ihre Kanonisation (1391). Ihre geistlichen Berater hatten ebenfalls ihre Offenbarungen gesammelt, aus dem Altschwedischen ins Lateinische übersetzt und redigiert, wenn dies ihnen aus theologischen oder kirchenpolitischen Gründen notwendig schien. Zugleich wurden erste Lebensbeschreibungen Birgittas verfaßt, und noch vor Ende des vierzehnten Jahrhunderts entstanden Übertragungen in europäische Nationalsprachen.
Ganz im Gegensatz zur Ausstrahlung Birgittas in ihrer Zeit und zu ihrem Nachleben in der katholischen Christenheit hat sich die historische Forschung dieser Gestalt bisher nur wenig zugewandt. Eine kritische Edition der "Offenbarungen" wurde in den 1950er Jahren begonnen und ist bis heute nicht abgeschlossen. Erst sie kann jedoch den Anteil der Heiligen an den Texten selbst klären und damit eine verläßliche Grundlage für ein Urteil über Entstehung und Wirkung der Visionen und Prophezeiungen geben. Ebenso mangelt es an einer geistes- und religionsgeschichtlichen Einordnung Birgittas, besonders im Vergleich mit den anderen Protagonistinnen der religiösen Frauenbewegung des hohen Mittelalters. Andererseits befriedigt eine Gestalt wie Birgitta offenbar ein verbreitetes historisches Interesse an Lebensgestaltungen von Frauen, bei denen die Macht des Irrationalen dominiert und die Grenze zur Esoterik verschwimmt. Wenn sich dazu noch ein Jubiläumsjahr anbietet - hier der siebenhundertste Geburtstag der Heiligen -, dann findet sich wohl auch bald ein Autor, der Neugier mehr als Sachkunde anzubieten hat.
Um ein solches Werk handelt es sich bei dem Buch von Günther Schiwy, das sich den Titel einer Biographie Birgittas anmaßt. Schiwy ist der Ausbildung nach Theologe und Jesuit, also kein Historiker, und sucht seit längerem die in der Moderne verlorengegangene Einheit von Mensch und Gott, Mensch und Natur, Mensch und Kosmos durch biographische Studien zurückzugewinnen. Diesem Ziel dienten schon seine Bücher über den Paläontologen Teilhard de Chardin und den romantischen Dichter Eichendorff, zu denen sich jetzt dasjenige über Birgitta von Schweden fügt. Allerdings hat sich Schiwy nicht einmal die Mühe gemacht, die Relevaciones der schwedischen Seherin im Original zu lesen; seine Darstellung beruht auf einer deutschen Übersetzung des Werkes von 1856/1888. Kein Wunder, daß der Autor nirgendwo zu einer Analyse der Texte ansetzt, die einen originellen Gedanken hervorbringen könnte. Wo Schiwy Urteile zuspitzt, stützt er sich auf dezidierte Äußerungen anderer. Leider verfügt er auch nur über ein bescheidenes Erzähltalent. Deshalb läßt er Birgitta und weitere mittelalterliche Autoren in seitenlangen Zitaten zu Worte kommen. Er vermutet wohl, daß sich historische Texte von selbst erschließen, und weiß nichts davon, daß scheinbar eingängige Quellen früherer Zeiten "auf Distanz" gebracht oder verfremdet werden müssen, bevor man sie in ihrer Andersartigkeit überhaupt begreifen kann. Seine Textmontage aus Quellenzitaten wird unterbrochen durch umgearbeitete Lexikonartikel zu historischen Sachverhalten, die er in ständigen Exkursen einführt, wo dies der Lebensgang Birgittas zu erfordern scheint. Viel Überflüssiges wird da mitgeteilt, alles Präsentierte gleicht aber unbehauenen Steinblöcken, die sich nirgends zu einem eng verfugten, nicht zu reden: zu einem kunstvollen, Gebäude ordnen. Ein Autor, der sich in Wort und Gedanke so wenig um seine Aufgabe bemüht, hat seiner Heldin und seinem Anliegen einen zweifelhaften Dienst erwiesen.
MICHAEL BORGOLTE
Günther Schiwy: "Birgitta von Schweden". Mystikerin und Visionärin des späten Mittelalters. Verlag C. H. Beck, München 2003. 431 S., 84 Abb., 1 Karte, geb., 29,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main







 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.05.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.05.2003