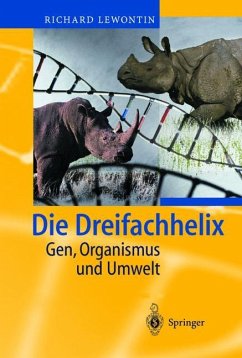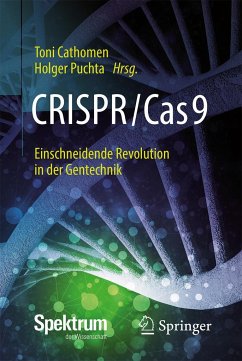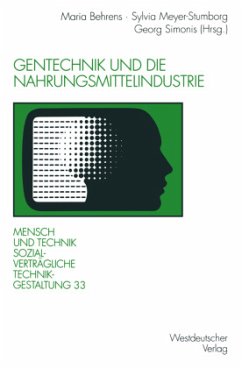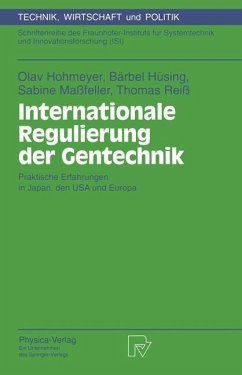Nicht lieferbar
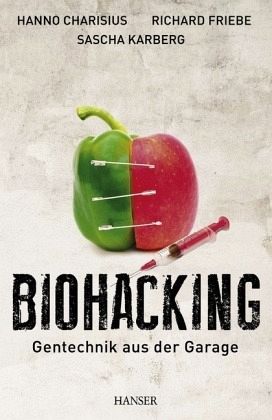
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar





Bislang war Genforschung Profiwissenschaftlern vorbehalten. Diese Zeiten sind vorbei, meinen die Wissenschaftsjournalisten Hanno Charisius, Richard Friebe und Sascha Karberg. Sie bauten mit einem Mini-Budget ein eigenes Labor auf, analysierten ihre Erbanlagen und hantierten sogar mit potenziell gefährlichen Genen. Mit ihrem zweijährigen Selbstversuch stiegen sie ein in die Welt der "Biohacker" und trafen die Pioniere dieser neuen Amateurforschungs-Bewegung, die sich in Underground-Labors an Krebsforschung versuchen. Wer sind diese Hacker des Lebens-Codes? Welche Chancen und Gefahren birgt di...
Bislang war Genforschung Profiwissenschaftlern vorbehalten. Diese Zeiten sind vorbei, meinen die Wissenschaftsjournalisten Hanno Charisius, Richard Friebe und Sascha Karberg. Sie bauten mit einem Mini-Budget ein eigenes Labor auf, analysierten ihre Erbanlagen und hantierten sogar mit potenziell gefährlichen Genen. Mit ihrem zweijährigen Selbstversuch stiegen sie ein in die Welt der "Biohacker" und trafen die Pioniere dieser neuen Amateurforschungs-Bewegung, die sich in Underground-Labors an Krebsforschung versuchen. Wer sind diese Hacker des Lebens-Codes? Welche Chancen und Gefahren birgt die neue Makers-Bewegung der Biotechnologie? Und wie sollten Politik und Gesellschaft auf sie reagieren?
Charisius, Hanno
Hanno Charisius, Jahrgang 1972, studierte Biologie in Bremen. Er hat unter anderem als Redakteur beim MIT Technology Review und Wired gearbeitet. 2010/11 war er Wissenschaftsjournalismus-Stipendiat am Massachusetts Institute of Technology. Er lebt in München.
Friebe, Richard
Richard Friebe ist Evolutionsbiologe und Journalist. Als Wissenschaftsautor schreibt er u. a. für FAZ, FAS, SZ, Stern und Time Magazine. Er war in leitender Funktion als Redakteur u. a. beim Süddeutschen Verlag tätig und war Research Fellow am Massachusetts Institute of Technology. Mehrfach wurde seine Arbeit prämiert, unter anderem mit dem Georg von Holtzbrinck Preis, der renommiertesten Auszeichnung für Wissenschaftsjournalismus im deutschsprachigen Raum. Seine gemeinsam mit Kollegen verfassten Bücher »Biohacking« und »Bund fürs Leben« wurden mehrfach für Preise nominiert und ausgezeichnet.
Hanno Charisius, Jahrgang 1972, studierte Biologie in Bremen. Er hat unter anderem als Redakteur beim MIT Technology Review und Wired gearbeitet. 2010/11 war er Wissenschaftsjournalismus-Stipendiat am Massachusetts Institute of Technology. Er lebt in München.
Friebe, Richard
Richard Friebe ist Evolutionsbiologe und Journalist. Als Wissenschaftsautor schreibt er u. a. für FAZ, FAS, SZ, Stern und Time Magazine. Er war in leitender Funktion als Redakteur u. a. beim Süddeutschen Verlag tätig und war Research Fellow am Massachusetts Institute of Technology. Mehrfach wurde seine Arbeit prämiert, unter anderem mit dem Georg von Holtzbrinck Preis, der renommiertesten Auszeichnung für Wissenschaftsjournalismus im deutschsprachigen Raum. Seine gemeinsam mit Kollegen verfassten Bücher »Biohacking« und »Bund fürs Leben« wurden mehrfach für Preise nominiert und ausgezeichnet.
Produktdetails
- Verlag: Hanser
- Seitenzahl: 288
- Erscheinungstermin: 21. Februar 2013
- Deutsch
- Abmessung: 218mm x 147mm x 26mm
- Gewicht: 500g
- ISBN-13: 9783446435025
- ISBN-10: 3446435026
- Artikelnr.: 36891136
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Hundekot genetisch untersuchen, das möchte Diemut Klärner nicht unbedingt. Das vorliegende Buch über Biohacking, Laienexperimente mit Tier-DNA, hat sie dennoch gerne gelesen. Zum einen, weil die Autoren ihre Begegnungen mit Do-it-yourself-Biologen und privatgelehrten Praktikern auf dem Gebiet der Genetik anschaulich und unterhaltsam schildern. Zum anderen, da sie einen gesellschaftlichen Diskurs anstoßen über die Lust wie über die Risiken eines ungewöhnlichen Hobbys.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.03.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.03.2013Bürgerwissenschaftler an die Forschungsfront!
Mach's doch am besten gleich selbst: Die Journalisten Hanno Charisius, Sascha Karberg und Richard Friebe versuchen sich als Biohacker - und kommen dabei auf den Hund
Es riecht nicht angenehm aus der Ecke eines Berliner Gemeinschaftsbüros, in der sich die Autoren ein kleines Labor eingerichtet haben. Dort wollen sie aus einem Hundehaufen, den sie im Park gefunden haben, die Erbsubstanz des zugehörigen Hunds herausfischen. Für Profis kein Problem, denn mit den Überresten der Verdauung kommen stets auch Darmzellen samt DNA zum Vorschein. Doch Hanno Charisius, Sascha Karberg und Richard Friebe sind keine Profis. Alle drei haben ein Biologiestudium absolviert, sind aber
Mach's doch am besten gleich selbst: Die Journalisten Hanno Charisius, Sascha Karberg und Richard Friebe versuchen sich als Biohacker - und kommen dabei auf den Hund
Es riecht nicht angenehm aus der Ecke eines Berliner Gemeinschaftsbüros, in der sich die Autoren ein kleines Labor eingerichtet haben. Dort wollen sie aus einem Hundehaufen, den sie im Park gefunden haben, die Erbsubstanz des zugehörigen Hunds herausfischen. Für Profis kein Problem, denn mit den Überresten der Verdauung kommen stets auch Darmzellen samt DNA zum Vorschein. Doch Hanno Charisius, Sascha Karberg und Richard Friebe sind keine Profis. Alle drei haben ein Biologiestudium absolviert, sind aber
Mehr anzeigen
längst im Journalismus heimisch und planen keinen Berufswechsel. Vielmehr recherchieren sie gemeinsam über Freizeit-Biologen, die mit DNA hantieren.
Um besser zu verstehen, was es mit dieser Do-it-yourself-Biologie, auch Biohacking genannt, auf sich hat, betreiben die Autoren eine "Art von experimentellem Journalismus". Auf den Hund gekommen sind sie nicht zuletzt deshalb, weil sich alles im Rahmen von Recht und Gesetz abspielen soll. Die DNA eines Menschen ohne dessen Zustimmung zu untersuchen ist hierzulande verboten. Hunde hingegen genießen nicht dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Deshalb lässt sich der gesammelte Hundedreck guten Gewissens für einen genetischen Fingerabdruck verwenden. Was zum Leidwesen der Bürogemeinschaft allerdings nicht auf Anhieb gelingt, sondern erst nach einer Woche. Als die Luft wieder rein ist, gilt es herauszufinden, von welchem Hund der Haufen stammte. Trickreich animieren die Journalisten etliche Hunde im Park, mit kleinen Gummibällen zu spielen. Ihre Ausbeute kann sich sehen lassen: ein Dutzend Bälle mit Speichelproben. Mit dem genetischen Fingerabdruck klappt es leider nur bei vieren. Immerhin, im Prinzip hat es funktioniert, mit einer Ausrüstung, die sich jeder beschaffen könnte. Es kostet nur Mühe und ein paar tausend Euro.
Nach drei Experimenten mit durchwachsenem Erfolg können die Autoren abschätzen, wie penibel und geduldig man vorgehen muss und wie weit man derzeit als Do-it-yourself-Biologe kommen kann. Sie wissen aber nicht nur ihre praktischen Erfahrungen anschaulich und unterhaltsam zu schildern. Ebenso flott erzählen sie von Begegnungen mit Zeitgenossen, die bei der Do-it-yourself-Biologie angebissen haben. In dieser Szene sind keineswegs nur Amateure aktiv. Eine Absolventin des Massachusetts Institute of Technology ist schon früh dazugestoßen, weil ihre Familie mit dem üblichen Medizinbetrieb schlechte Erfahrungen gemacht hatte. So wollte sie auf eigene Faust testen, ob sie die Stoffwechselkrankheit ihres Vaters geerbt hat. Ein Mini-Labor, mit einfachsten Mitteln in einem Kleiderschrank eingerichtet, ermöglichte ihr den Gentest, der Entwarnung gab.
In einem Gemeinschaftslabor für New Yorker Biohacker trafen die Autoren einen Molekularbiologen von der Cornell University, der in seiner Freizeit versucht, lebende Bakterien aus der Stratosphäre zu fangen und zu studieren. Wissenschaftler wie er nutzen das für jeden offene Labor aber nicht nur für eigene Projekte. Sie veranstalten dort auch Einsteiger-Kurse. Ein wichtiger Aspekt sind fachgerechte Sicherheitschecks, die alle akzeptieren müssen, ob sie sich nun als Forscher verstehen oder als Künstler. In einem der Kunstprojekte sollen isolierte Mäusezellen beispielsweise so verändert werden, dass sie nach jeder Zellteilung die Farbe wechseln.
Gemeinschaftslabors, in denen man für einen moderaten Mitgliedsbeitrag nach Herzenslust experimentieren kann, das wünschen sich Hanno Charisius, Sascha Karberg und Richard Friebe auch hierzulande. Nicht nur, um sicherzustellen, dass niemand Unfug anrichtet und sich oder seine Umwelt gefährdet. Aus ihrer Sympathie für das bunte Völkchen der Biohacker machen die Autoren keinen Hehl. Zugegeben, bisher beschränken sich die meisten Do-it-yourself-Enthusiasten darauf, mit geringem technischem Aufwand simple Experimente nachzukochen. Sonderlich aufregende Ergebnisse sind nicht zu erwarten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Denn was man so braucht für ein bisschen Molekulargenetik, wird immer erschwinglicher und handlicher.
Die Autoren sehen Do-it-yourself-Biologen in der langen Tradition all jener, die ohne einschlägiges Studium ihren Beitrag zu den Naturwissenschaften geleistet haben. Nach wie vor tummeln sich die meisten dieser "Bürgerwissenschaftler" auf dem Terrain der Feld-Wald-und-Wiesen-Biologie. Ohne sie gäbe es keine detaillierten Verbreitungskarten, weder für den Eisvogel noch für das Weiße Waldvöglein. Mittlerweile erleichtert das Internet die Vernetzung, und es eröffnet neue Felder für engagierte Laien. Wen es in die Weiten des Weltalls zieht, der kann mit seinem Computer nach unbekannten Objekten am Nachthimmel suchen. Mit einer kleinen Chance, fündig zu werden: Denn professionellen Astronomen fehlt es an Zeit, um die Bilderflut ihrer Teleskope akribisch genug unter die Lupe zu nehmen.
Ob es um ferne Sterne geht oder um die Natur vor der Haustür - wer sich als Freizeit-Wissenschaftler betätigt, dem winken Erfolgserlebnisse und Anerkennung in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, Laien und Profis. Gerade in der oft heißumstrittenen Gentechnik versprechen sich die Autoren darüber hinaus auch mehr demokratische Teilhabe an der Forschung. Allerdings, so räumen sie ein, macht es schon einen Unterschied, ob jemand verschiedenfarbige Schnirkelschnecken zählt oder mit DNA hantiert.
Die Do-it-yourself-Biologen, denen das Autoren-Trio begegnet ist, mögen allesamt guten Willens sein. Doch wer es darauf anlegt, kann sich durchaus die nötigen Zutaten beschaffen, um ein Gen für einen tödlichen Giftstoff zu isolieren. Das Gift hat man damit zwar noch lange nicht in der Hand, Gemeingefährliches herzustellen scheint aber grundsätzlich möglich. Wie bei Computerhackern gibt es also auch bei Biohackern Spielraum für jene, die nichts Gutes im Schilde führen. Gezielt und treffsicher Schaden anzurichten ist mit anderen Mitteln bislang jedoch einfacher.
Wenn sich Computerbastler als Do-it-yourself-Biologen versuchen, werden sie nicht nur mit Pipetten und anderen ungewohnten Gerätschaften konfrontiert. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass sich Fehler kaum rückgängig machen lassen und eine Kleinigkeit tagelange Mühen zunichtemachen kann. Hartnäckige Biohacker werden bei der Stange bleiben, wenn ihnen klar wird, dass sich Erbinformation nicht so leicht programmieren lässt. Ob sie dann mit der Zeit ein Gespür dafür bekommen, wie faszinierend komplex biologische Systeme sind und wie wenig berechenbar für jeden, der in Neuland vorstoßen will? Über das Risiko, dass manche Biohacker womöglich ahnungslos mit dem Feuer spielen, sprechen die Autoren nicht explizit, aber sie halten einen gesellschaftlichen Diskurs darüber für wünschenswert.
DIEMUT KLÄRNER.
Hanno Charisius, Sascha Karberg und Richard Friebe: "Biohacking". Gentechnik aus der Garage.
Mit Illustrationen von Veronique Ansorge. Hanser Verlag, München 2013. 286 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Um besser zu verstehen, was es mit dieser Do-it-yourself-Biologie, auch Biohacking genannt, auf sich hat, betreiben die Autoren eine "Art von experimentellem Journalismus". Auf den Hund gekommen sind sie nicht zuletzt deshalb, weil sich alles im Rahmen von Recht und Gesetz abspielen soll. Die DNA eines Menschen ohne dessen Zustimmung zu untersuchen ist hierzulande verboten. Hunde hingegen genießen nicht dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Deshalb lässt sich der gesammelte Hundedreck guten Gewissens für einen genetischen Fingerabdruck verwenden. Was zum Leidwesen der Bürogemeinschaft allerdings nicht auf Anhieb gelingt, sondern erst nach einer Woche. Als die Luft wieder rein ist, gilt es herauszufinden, von welchem Hund der Haufen stammte. Trickreich animieren die Journalisten etliche Hunde im Park, mit kleinen Gummibällen zu spielen. Ihre Ausbeute kann sich sehen lassen: ein Dutzend Bälle mit Speichelproben. Mit dem genetischen Fingerabdruck klappt es leider nur bei vieren. Immerhin, im Prinzip hat es funktioniert, mit einer Ausrüstung, die sich jeder beschaffen könnte. Es kostet nur Mühe und ein paar tausend Euro.
Nach drei Experimenten mit durchwachsenem Erfolg können die Autoren abschätzen, wie penibel und geduldig man vorgehen muss und wie weit man derzeit als Do-it-yourself-Biologe kommen kann. Sie wissen aber nicht nur ihre praktischen Erfahrungen anschaulich und unterhaltsam zu schildern. Ebenso flott erzählen sie von Begegnungen mit Zeitgenossen, die bei der Do-it-yourself-Biologie angebissen haben. In dieser Szene sind keineswegs nur Amateure aktiv. Eine Absolventin des Massachusetts Institute of Technology ist schon früh dazugestoßen, weil ihre Familie mit dem üblichen Medizinbetrieb schlechte Erfahrungen gemacht hatte. So wollte sie auf eigene Faust testen, ob sie die Stoffwechselkrankheit ihres Vaters geerbt hat. Ein Mini-Labor, mit einfachsten Mitteln in einem Kleiderschrank eingerichtet, ermöglichte ihr den Gentest, der Entwarnung gab.
In einem Gemeinschaftslabor für New Yorker Biohacker trafen die Autoren einen Molekularbiologen von der Cornell University, der in seiner Freizeit versucht, lebende Bakterien aus der Stratosphäre zu fangen und zu studieren. Wissenschaftler wie er nutzen das für jeden offene Labor aber nicht nur für eigene Projekte. Sie veranstalten dort auch Einsteiger-Kurse. Ein wichtiger Aspekt sind fachgerechte Sicherheitschecks, die alle akzeptieren müssen, ob sie sich nun als Forscher verstehen oder als Künstler. In einem der Kunstprojekte sollen isolierte Mäusezellen beispielsweise so verändert werden, dass sie nach jeder Zellteilung die Farbe wechseln.
Gemeinschaftslabors, in denen man für einen moderaten Mitgliedsbeitrag nach Herzenslust experimentieren kann, das wünschen sich Hanno Charisius, Sascha Karberg und Richard Friebe auch hierzulande. Nicht nur, um sicherzustellen, dass niemand Unfug anrichtet und sich oder seine Umwelt gefährdet. Aus ihrer Sympathie für das bunte Völkchen der Biohacker machen die Autoren keinen Hehl. Zugegeben, bisher beschränken sich die meisten Do-it-yourself-Enthusiasten darauf, mit geringem technischem Aufwand simple Experimente nachzukochen. Sonderlich aufregende Ergebnisse sind nicht zu erwarten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Denn was man so braucht für ein bisschen Molekulargenetik, wird immer erschwinglicher und handlicher.
Die Autoren sehen Do-it-yourself-Biologen in der langen Tradition all jener, die ohne einschlägiges Studium ihren Beitrag zu den Naturwissenschaften geleistet haben. Nach wie vor tummeln sich die meisten dieser "Bürgerwissenschaftler" auf dem Terrain der Feld-Wald-und-Wiesen-Biologie. Ohne sie gäbe es keine detaillierten Verbreitungskarten, weder für den Eisvogel noch für das Weiße Waldvöglein. Mittlerweile erleichtert das Internet die Vernetzung, und es eröffnet neue Felder für engagierte Laien. Wen es in die Weiten des Weltalls zieht, der kann mit seinem Computer nach unbekannten Objekten am Nachthimmel suchen. Mit einer kleinen Chance, fündig zu werden: Denn professionellen Astronomen fehlt es an Zeit, um die Bilderflut ihrer Teleskope akribisch genug unter die Lupe zu nehmen.
Ob es um ferne Sterne geht oder um die Natur vor der Haustür - wer sich als Freizeit-Wissenschaftler betätigt, dem winken Erfolgserlebnisse und Anerkennung in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, Laien und Profis. Gerade in der oft heißumstrittenen Gentechnik versprechen sich die Autoren darüber hinaus auch mehr demokratische Teilhabe an der Forschung. Allerdings, so räumen sie ein, macht es schon einen Unterschied, ob jemand verschiedenfarbige Schnirkelschnecken zählt oder mit DNA hantiert.
Die Do-it-yourself-Biologen, denen das Autoren-Trio begegnet ist, mögen allesamt guten Willens sein. Doch wer es darauf anlegt, kann sich durchaus die nötigen Zutaten beschaffen, um ein Gen für einen tödlichen Giftstoff zu isolieren. Das Gift hat man damit zwar noch lange nicht in der Hand, Gemeingefährliches herzustellen scheint aber grundsätzlich möglich. Wie bei Computerhackern gibt es also auch bei Biohackern Spielraum für jene, die nichts Gutes im Schilde führen. Gezielt und treffsicher Schaden anzurichten ist mit anderen Mitteln bislang jedoch einfacher.
Wenn sich Computerbastler als Do-it-yourself-Biologen versuchen, werden sie nicht nur mit Pipetten und anderen ungewohnten Gerätschaften konfrontiert. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass sich Fehler kaum rückgängig machen lassen und eine Kleinigkeit tagelange Mühen zunichtemachen kann. Hartnäckige Biohacker werden bei der Stange bleiben, wenn ihnen klar wird, dass sich Erbinformation nicht so leicht programmieren lässt. Ob sie dann mit der Zeit ein Gespür dafür bekommen, wie faszinierend komplex biologische Systeme sind und wie wenig berechenbar für jeden, der in Neuland vorstoßen will? Über das Risiko, dass manche Biohacker womöglich ahnungslos mit dem Feuer spielen, sprechen die Autoren nicht explizit, aber sie halten einen gesellschaftlichen Diskurs darüber für wünschenswert.
DIEMUT KLÄRNER.
Hanno Charisius, Sascha Karberg und Richard Friebe: "Biohacking". Gentechnik aus der Garage.
Mit Illustrationen von Veronique Ansorge. Hanser Verlag, München 2013. 286 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
"Über ihre Erfahrungen als Biohacker schreiben die drei Autoren spannend, locker und leicht verständlich." Michael Lange, WDR 5, 01.03.2013
"Die drei Wissenschaftsjournalisten [...] haben diese Bewegung in einem spannenden Buch porträtiert." Technology Review, März 2013
"Ein spannendes Buch, das den Leser in das Thema hineinzieht: informativ, unterhaltsam, niemals reißerisch und erst recht niemals langweilig." Dagmar Röhrlich, Deutschlandfunk, 17.03.2013
"`Biohacking ist im Moment die wahrscheinlich beste Informationsquelle zum Thema DIY-Biologie und wird alle überraschen, die gerne selber experimentieren [...]." Julia Heymann, Spektrum der Wissenschaft, 20.03.2013
"Ein packender Wissenschaftsthriller, der den Leser schaudern lässt." P.M.-Magazin, Mai 2013
"Spannend und auch für den biologischen Laien verständlich geschrieben, lassen sie den Leser an ihrem `beispiellosen, zweijährigen Selbstversuch teilhaben." Tim Haarmann, Spektrum der Wissenschaft, Juni 2013
"[Die Autoren] wissen aber nicht nur ihre praktischen Erfahrungen anschaulich und unterhaltsam zu schildern. Ebenso flott erzählen sie von Begegnungen mit Zeitgenossen, die bei der Do-it-yourself-Biologie angebissen haben." Diemut Klärner, FAZ, 26.03.13
"Die drei Wissenschaftsjournalisten [...] haben diese Bewegung in einem spannenden Buch porträtiert." Technology Review, März 2013
"Ein spannendes Buch, das den Leser in das Thema hineinzieht: informativ, unterhaltsam, niemals reißerisch und erst recht niemals langweilig." Dagmar Röhrlich, Deutschlandfunk, 17.03.2013
"`Biohacking ist im Moment die wahrscheinlich beste Informationsquelle zum Thema DIY-Biologie und wird alle überraschen, die gerne selber experimentieren [...]." Julia Heymann, Spektrum der Wissenschaft, 20.03.2013
"Ein packender Wissenschaftsthriller, der den Leser schaudern lässt." P.M.-Magazin, Mai 2013
"Spannend und auch für den biologischen Laien verständlich geschrieben, lassen sie den Leser an ihrem `beispiellosen, zweijährigen Selbstversuch teilhaben." Tim Haarmann, Spektrum der Wissenschaft, Juni 2013
"[Die Autoren] wissen aber nicht nur ihre praktischen Erfahrungen anschaulich und unterhaltsam zu schildern. Ebenso flott erzählen sie von Begegnungen mit Zeitgenossen, die bei der Do-it-yourself-Biologie angebissen haben." Diemut Klärner, FAZ, 26.03.13
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für