Nicht lieferbar
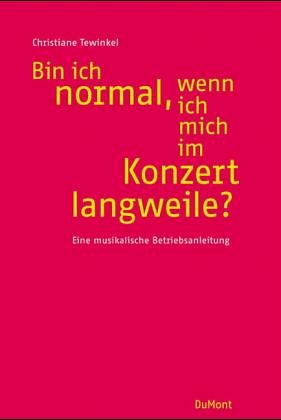
Bin ich normal, wenn ich mich im Konzert langweile?
Eine musikalische Betriebsanleitung
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
"Klassik ist geil." (Süddeutsche Zeitung)Wie viel Wissen braucht man, um ein Konzert zu besuchen? Muss ich das Programmheft lesen und warum darf ich zwischendurch nicht klatschen? Worüber spreche ich nach einem Konzert, ohne mich lächerlich zu machen? Und warum sind Konzerte so teuer - oder verdienen Musiker so viel? Was hat es mit den geheimen Gesetzen der Musik auf sich und muss ich die Sonatenhauptsatzform heraus hören? Wozu Dur und wozu moll? Was finden andere an der Oper, wo sich der Kunstgesang so eigenartig anhört und sich die Opernsänger unnormal bewegen? Könnte man nicht statt ...
"Klassik ist geil." (Süddeutsche Zeitung)
Wie viel Wissen braucht man, um ein Konzert zu besuchen? Muss ich das Programmheft lesen und warum darf ich zwischendurch nicht klatschen? Worüber spreche ich nach einem Konzert, ohne mich lächerlich zu machen? Und warum sind Konzerte so teuer - oder verdienen Musiker so viel? Was hat es mit den geheimen Gesetzen der Musik auf sich und muss ich die Sonatenhauptsatzform heraus hören? Wozu Dur und wozu moll? Was finden andere an der Oper, wo sich der Kunstgesang so eigenartig anhört und sich die Opernsänger unnormal bewegen? Könnte man nicht statt eines Dirigenten ein Metronom vor das Orchester stellen? Und warum hört sich Neue Musik oft so anstrengend an und überhaupt: Seit wann gibt es Klassische Musik und wie lange noch?
In diesem Buch finden Sie Antworten auf sämtliche Fragen zur Musik, die Sie immer schon hatten und doch nie zu stellen wagten. Eine Bestätigung, dass Sie längst genug wissen, gibt es gratis dazu. Schließlich muss Ihnen ke
Wie viel Wissen braucht man, um ein Konzert zu besuchen? Muss ich das Programmheft lesen und warum darf ich zwischendurch nicht klatschen? Worüber spreche ich nach einem Konzert, ohne mich lächerlich zu machen? Und warum sind Konzerte so teuer - oder verdienen Musiker so viel? Was hat es mit den geheimen Gesetzen der Musik auf sich und muss ich die Sonatenhauptsatzform heraus hören? Wozu Dur und wozu moll? Was finden andere an der Oper, wo sich der Kunstgesang so eigenartig anhört und sich die Opernsänger unnormal bewegen? Könnte man nicht statt eines Dirigenten ein Metronom vor das Orchester stellen? Und warum hört sich Neue Musik oft so anstrengend an und überhaupt: Seit wann gibt es Klassische Musik und wie lange noch?
In diesem Buch finden Sie Antworten auf sämtliche Fragen zur Musik, die Sie immer schon hatten und doch nie zu stellen wagten. Eine Bestätigung, dass Sie längst genug wissen, gibt es gratis dazu. Schließlich muss Ihnen ke



