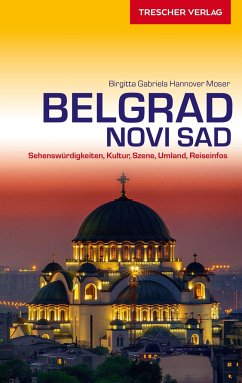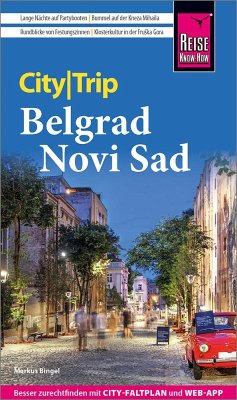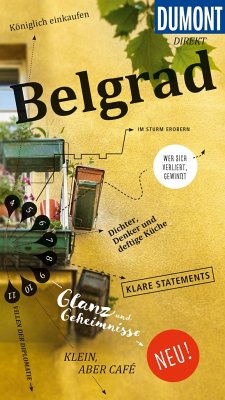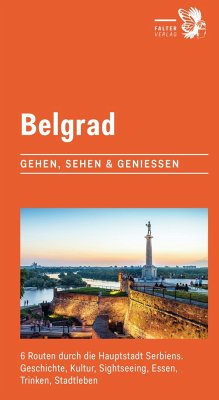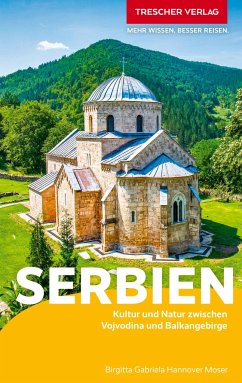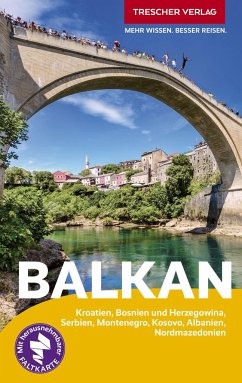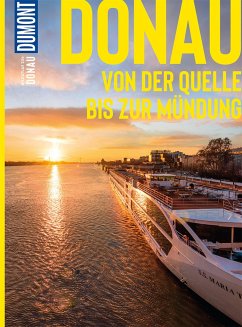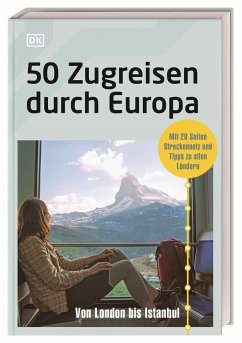Beograd Gazela
Reiseführer in eine Elendssiedlung
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 3-5 Tagen
19,80 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Obwohl es in Europa eine ganze Menge an Siedlungen gibt, die dem gängigen Sprachgebrauch nach als Slums oder Elendssiedlungen bezeichnet werden, fragt kaum jemand danach, warum es zu deren Entstehung kommt, wie es sich darin leben lässt und wie der Ort den Alltag seiner BewohnerInnen prägt. Besonders auffällig wird dies am Beispiel jener Elendssiedlung unterhalb der Autobahnbrücke Gazela, im Herzen Belgrads: täglich fahren Zehntausende an den Hütten und Baracken vorbei und dennoch gibt es kaum glaubwürdige Informationen über die Siedlung und die Menschen - in überwiegender Mehrheit R...
Obwohl es in Europa eine ganze Menge an Siedlungen gibt, die dem gängigen Sprachgebrauch nach als Slums oder Elendssiedlungen bezeichnet werden, fragt kaum jemand danach, warum es zu deren Entstehung kommt, wie es sich darin leben lässt und wie der Ort den Alltag seiner BewohnerInnen prägt. Besonders auffällig wird dies am Beispiel jener Elendssiedlung unterhalb der Autobahnbrücke Gazela, im Herzen Belgrads: täglich fahren Zehntausende an den Hütten und Baracken vorbei und dennoch gibt es kaum glaubwürdige Informationen über die Siedlung und die Menschen - in überwiegender Mehrheit Roma - die dort zu wohnen gezwungen sind.Ab welcher Größe ist eine Ansammlung von Hütten und Baracken als Siedlung zu betrachten? Was unterscheidet Hütten von Baracken? Wie lebt man ohne städtische Infrastruktur, ohne Wasser, ohne Strom? Wie organisieren sich die BewohnerInnen, welcher Arbeit gehen sie nach? Wie steht es mit ihrer medizinischen, wie mit ihrer kulturellen Versorgung?Der Reiseführer in eine Elendssiedlung führt in diesen weißen Fleck, um dessen Stellenwert im öffentlichen Bewusstsein neu zu definieren: einerseits sollen die LeserInnen dazu animiert werden, Gazela oder ähnliche Siedlungen zu besuchen, um sich unmittelbar mit der Situation auseinander zu setzen, andererseits werden grundlegende Informationen über die sozialen wie ökonomischen Strukturen und Zwänge bereitgestellt, unter denen die BewohnerInnen solcher Siedlungen zu leben gezwungen sind. Darüber hinaus macht der Reiseführer auf die vielschichtigen Mechanismen der Marginalisierung und Diskriminierung von Roma aufmerksam und will mit der fundierten Beschreibung dieses Soziotops eine Basis für weitere Initiativen schaffen. Zahlreiche Fotos, die zum Teil von den BewohnerInnen der Siedlung selbst stammen, erlauben auch denjenigen einen Einblick, welche sich nicht konkret auf diese Reise begeben wollen.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Entdecke weitere interessante Produkte
Stöbere durch unsere vielfältigen Angebote