Hausaufgaben, welche die unabhängige Professorengruppe dem Minister anklagend vorhält: ein zu niedriges Beschäftigungsniveau, eine schwache Dynamik im Dienstleistungsgewerbe, hohe und strukturell verfestigte Arbeitslosigkeit, ein großer Anteil Langzeitarbeitsloser und besondere Schwierigkeiten bei der Integration von Älteren, Geringqualifizierten und Frauen in das Erwerbsleben.
Zudem machen starre Arbeitsmarktregulierungen, die hohe Kostenbelastung des Faktors Arbeit und unzureichende Infrastrukturinvestitionen ein Nachsitzen unumgänglich. Nur mit Blick auf den Umgang mit qualifizierten und jüngeren Arbeitskräften wird Walter Riester ein "gut" ausgestellt. Insgesamt, so das Expertenurteil, ist die deutsche Arbeitsmarktbilanz im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich. Bitter für den Minister dürfte sein, daß die Benchmarking-Gruppe gerade dort Änderungsbedarf sieht, wo das Arbeitsministerium seine eigentlichen Stärken wähnt: bei Frauen, Älteren und Geringqualifizierten.
Aber nicht nur Walter Riester, auch Bundesfinanzminister Hans Eichel wird gerüffelt. So bemängeln die Forscher unter anderem die im internationalen Vergleich geringe deutsche Investitionsquote und stellen fest, daß trotz des offensichtlichen Nachholbedarfs der neuen Länder die öffentliche Infrastruktur vernachlässigt wird. Besonders kritisch an der staatlichen Investitionshaltung ist, daß private Unternehmen häufig erst dann Arbeitsplätze schaffen, wenn der Staat mit Infrastrukturprojekten die Grundlage gelegt hat. Deutschlands EU-Nachbarn haben diesen Zusammenhang offenbar bereits erkannt und entsprechend gehandelt. In den erfolgreichen EU-Ländern wurde der Staatskonsum gesenkt und wurden die Investitionen erhöht. Deutschland geht in die andere Richtung und ist EU-Schlußlicht im Wirtschaftswachstum. Auch in der Haushaltskonsolidierung weisen die Benchmarker darauf hin, daß Deutschland weit weniger konsequent die Zinslast oder das Finanzierungsdefizit bekämpft habe als seine europäischen Partner.
Neben so viel Kritikwürdigem finden die Verfasser aber auch Positives, vor allem im Sozialwesen: So zählt Deutschland zu den reichsten Ländern der Erde, sind nach Definition der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nur 8 Prozent aller Deutschen arm, gilt das duale Bildungssystem nach wie vor international als Vorbild. Sogar in der Arbeitsmarktpolitik gibt es Lichtblicke: So ist die tarifliche Wochenarbeitszeit zwar offiziell sehr kurz. Vergleicht man aber die tatsächlich geleisteten Wochenarbeitsstunden (durchschnittlich 41), stellt man fest, daß nur in Großbritannien wöchentlich mehr gearbeitet wird als im Land der Dichter und Denker. Auch die Verbreitung von flexiblen Arbeitszeitmodellen mit Arbeitszeitkonten lokalisieren die Experten auf der deutschen Habenseite.
Neben Lob und Tadel gibt es aber auch handfeste Hinweise, wie die Arbeitsmarktmisere angepackt werden kann. So stellen die Forscher fest, daß die finanzielle Belastung von Haushalten mit Kindern zwar vergleichsweise gering ist. Gleichzeitig fehle es aber an Kinderbetreuungseinrichtungen und Ganztagsschulen, die der Erwerbstätigkeit von Frauen im Wege stehen.
Mit Blick auf die Frage, wie die Möglichkeiten für Geringqualifizierte verbessert werden können, weisen die Forscher auf ihr Gutachten von 1999 hin. Bereits damals hatten sie gefordert, die Angebotsbedingungen insbesondere für personennahe Dienstleistungen zu verbessern, die Kosten dieser Dienstleistungen zu reduzieren und die Sozialabgaben auf einfache Arbeit insgesamt abzubauen. Hier sind die Erfahrungen aus Belgien und den Niederlanden mit der Differenzierung der Sozialabgaben oder aus Frankreich mit ihrer Beschäftigungsprämie hilfreich. Auch im Kampf gegen Arbeitslosigkeit im Alter können die EU-Nachbarn als Vorbild dienen. Während in Deutschland bloß über einen "Paradigmenwechsel" nachgedacht wird, schaffen andere Staaten Fakten und nehmen Vorruhestandprogramme zurück.
Ein Klassiker unter den Reformforderungen ist der Hinweis auf die beschäftigungshemmende Wirkung ausgeprägter Kündigungsschutzbestimmungen. Der Schutz des Arbeitsplatzes verschafft zwar Insidern eine gewisse Sicherheit und kann damit Investitionen in Humankapital fördern. Gleichzeitig aber versperren die Schutzregeln den Problemgruppen des Arbeitsmarktes wie Frauen, Älteren und Geringqualifizierten den Zugang zu Lohn und Brot und wirken damit kontraproduktiv.
Nur in einem Punkt dürften die Forderungen der Forschergruppe dem Arbeitsminister kaum Kopfzerbrechen bereiten: mit Blick auf Beratung und Vermittlung von Arbeitslosen. Hier liegt der Schwerpunkt des "Job-Aqtiv-Gesetzes", das der Bundestag beschlossen hat. Dennoch: die Zeit drängt. Nur knapp acht Monate bleiben der Bundesregierung, um ihre beschäftigungspolitischen Hausaufgaben zu erledigen.
ANDREAS GEHLHAAR
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
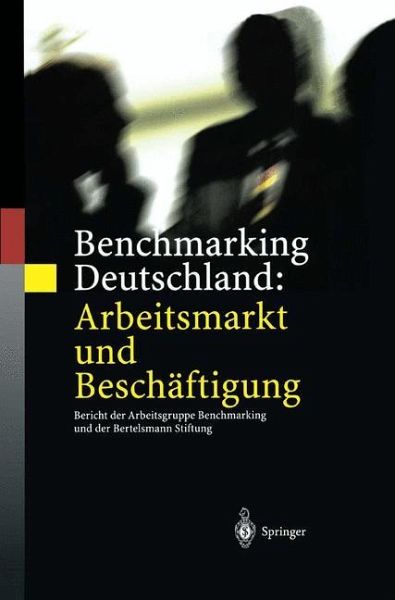






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.02.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.02.2002