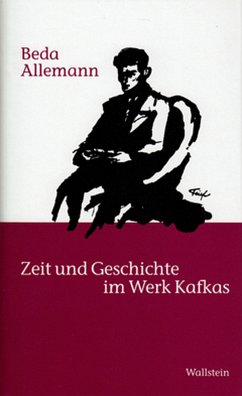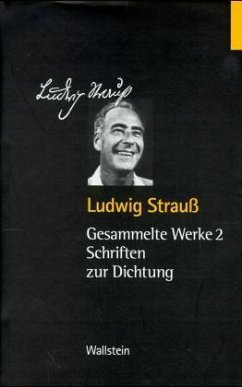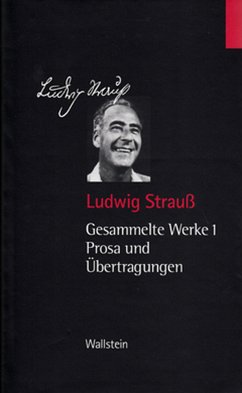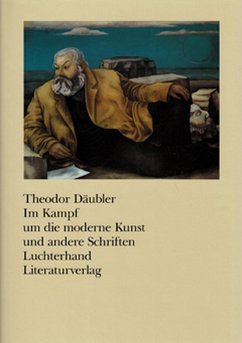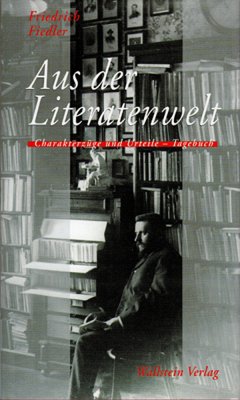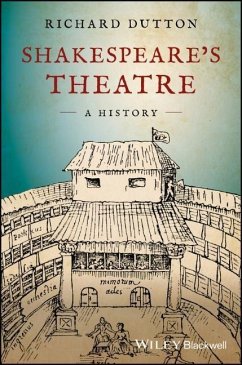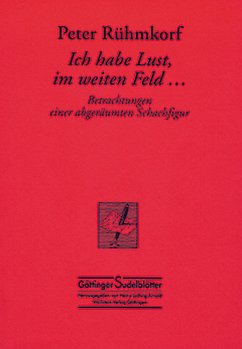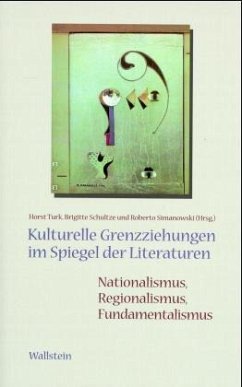Auswahl versammelt; Verdächtiges springt hier nicht in den Blick. Der erste Eindruck ist vielmehr einer von Fülle und Glanz.
Rychner, der sich in den zwanziger Jahren als Redakteur der "Neuen Schweizer Rundschau" einen Namen gemacht hatte, ab 1933 Sonderkorrespondent der "Neuen Zürcher Zeitung" war und von 1939 bis 1962 das Feuilleton der Zürcher Tageszeitung "Die Tat" leitete, ist ein Autor, der ebenso einfühlsam über Lessing und Lichtenberg, Rahel, Goethe und Jean Paul schreibt wie über Proust, Valéry, Gide und Kraus, Pound, Benn und Benjamin. Vor allem ist er ein geduldiger und genauer Leser, der es ernst meint mit der Kunst, der den Büchern nichts überstülpt und sie nicht als Wattebausch mißbraucht, auf dem die immer gleichen grauen Sporen einer präfabrizierten Theorie zu keimen haben.
Rychner konnte nicht ahnen, wieviel damit am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts schon gewonnen sein würde. An Selbstbewußtsein hat es ihm dabei nicht gefehlt. Sehr demütig sei er, sagte er von sich, und sehr hochmütig, "orgueuilleux et timide, wie Flaubert den Schriftsteller definierte". Die Mischung ist bewährt, wenn die beiden Teile sich aufwiegen. Bei Rychner scheint sich allerdings ein kleines Ungleichgewicht aufzutun. Wenn er nicht zuviel Stolz hätte, sondern zuviel Demut?
Wie Max Rychner über Goethe schreibt, ist von einer Verzücktheit, wie sie sonst Sektenführern zuteil wird. Hier fehlt das Salz, der kalte Blick für das Monströse am großen Mann, der Sinn fürs Monströse vielleicht überhaupt. Rychner konnte scharf sein, wie man aus dem Nachwort erfährt, bei anderen Gelegenheiten aber ist er sonderbar lau, womit wohl zusammenhängt, was Thomas Manns Tochter als verdächtig empfand. Das ist der zweite Eindruck bei der Lektüre dieser Schriften. Ein bißchen ordentlich, harmonisierend alles und viel noble ennui; zuviel "Daimon" und Überzeitliches, etwas leicht Schwiemeliges auch, wenn er etwa im Rahel-Essay 1959 über das "Gattungshafte, das mit ihrer Abstammung ihr auferlegt war", schreibt, "da sie ja doch in das Höchste dieses Volkes" - der Deutschen - "teilnehmend und sich selbst beitragend einbezogen war" - das ist der Rychner, auf den man ganz gut verzichten könnte, mit seinen zwischen Samstagsartikel und Sonntagsrede schwebenden Gestelztheiten und den von Edelfäule überzogenen Worttrauben, die ihr vielleicht gediegenstes Spalier in dem Nachruf auf Hugo von Hofmannsthal finden: "Das ,deutsche Werden'", heißt es dort, "als Wesensgrundzug der Deutschen aufgewiesen, anerkannt und vergöttlicht, bedarf, soll sich der Geist der Nation zu einer höchsten Ordnung umfassend erheben, einer Ergänzung."
Umfassend erheben - was für eine aufgequollene Sprache für den am besten schreibenden aller Eidgenossen! Und nicht jeder in dieser Zeit mußte auf das blühende Wald-und-Wesen-Gerede hereinfallen, wie einige der von ihm Verehrten am besten bezeugen. Max Rychner hat es gern höchst ordentlich und umfassend erhoben, aber bloß nicht extrem. Es wird alles nicht so heiß gegessen bei ihm; koche draußen auch die Hölle.
Einmal ein Satz wie der Thomas Manns von dem "tödlichen Haß", mit dem er Hitler verfolge! Aber Rychner erregt sich nicht, und wenn "Tragödie" nicht der schlimmste Scheltbegriff ist, den er für die Bestialitäten der Zeit aufbringt, so ist es die immer noch theatralisch eingefriedete "Katastrophe". Hier fehlen ihm die Worte oder der Sinn, aber irgendwas fehlt.
Am besten ist Rychner bei den Zeitgenossen, und am besten ist er privat. Darin liegt der große Vorteil dieser Sammlung und ihres Kommentars, daß sie die Stärken dokumentiert. Die Auswahl, die willkürlich erscheinen könnte, setzt sich logisch aus drei Hauptgruppen zusammen, dem Repräsentativen, den weniger bekannten Aufsätzen, die Rychner nicht in seine Sammlungen aufgenommen hat, und drittens: der Korrespondenz.
Dieser dritte Teil ist nicht der unbedeutendste, im Gegenteil fühlt man sich an Jean Pauls von Rychner zitierte "Verkehrtbrücke" erinnert, pons heteroclitus, "wo der Mensch hinabzugehen glaubt durch Aufsteigen".
Die markantesten Formulierungen Max Rychners und seine eigenwilligsten Urteile finden sich nicht im Publizierten und also Redigierten, sondern in seinen Briefen: die Bemerkung an Curtius über Arno Schmidt etwa - "Räuspern und Spucken wie Benn, ohne Benns pectus. Zuviel Manier, zuwenig Substanz" -, oder die Erinnerung an Karl Kraus, den er zunächst in einem jugendlichen Essay verherrlicht und später kennenlernt, schwer "entsetzt von seiner dürftigen und kargen Menschlichkeit".
In dem Briefteil findet sich auch Max Rychners Urteil über Robert Musil, dessen Lektüre er, wie er gesteht, abgebrochen habe - eine große Intelligenz, in dessen eisig amusischer Sphäre alles sterbe ("Ich machte beim Lesen oft die Fingergabel wie vor einem iettatore"), oder die Charakterisierung von Georg Lukács schließlich, der, so schreibt er, im Panzer der Lehre stecke - "aber zu allen Schlitzen hinaus streckt er künstlerisch empfindliche Tentakeln, die eine Menge von Dingen jenseits der Dogmen wahrnehmen".
Solche Tentakeln stehen Rychner in Büscheln zu Gebote, natürlich auch in den zahlreichen repräsentativen Stücken, die keineswegs alle abfallen gegen das privat Hingeworfene. Kein Wort etwa gegen den großen Lichtenberg-Aufsatz, geschrieben zu einer Zeit, als Lichtenberg noch lange nicht wieder Mode war. Ein paar Silben aber schon gegen die ebenso groß angelegte "Arachne". Die kommentierende Nacherzählung des von Ovid geschilderten Wettwebens zwischen Pallas Athene und einer ihr ebenbürtigen Menschenfrau, die nach einem tadellosem Teppichfinale von der Göttin und schlechten Verliererin gedemütigt und in eine Spinne verwandelt wird, als sie sich im Trotz erhängen will - das ist ein Essay, der ebenso makellos wäre wie der Teppich Arachnens, hätte er rechts unten nur einen anderen Namen eingewebt.
Es ist eine Arbeit von Thomas Mann, leicht erkennbar an einem Dutzend stilistischer Details, die leider nur ein anderer verfaßt hat, der Präsident der Thomas-Mann-Gesellschaft, der sich anders als Proust seine Meister nicht durch purgierende Pastiches vom Leibe schrieb und darum verdonnert ist, sie unfreiwillig zu liefern; immer noch glänzend, aber zu abhängig im Ton und damit letztlich verloren.
Es gibt aber in diesen Artikeln gröbere Fehler als die Abhängigkeit, es gibt Längen bei ihm und auch schlecht Redigiertes; er kann das gleiche dreimal sagen, wie etwa im Artikel über Herman Bang, in dem er auch die unschöne Komik nicht bemerkt, die sich in den Satz einschleicht, der Bangs Tod schildert - "in einem Eilzug ward er von ihm ereilt" -; was an der doppelt Genannten liegen wird, der er als Zeitungsmann nicht entgehen konnte.
Etwas ganz anderes ist es, wenn er sich, Freund und Förderer so vieler großer Geister, aufs persönlich erlebte Detail wirft und von seinen kleinen Gipfeltreffen erzählt. Das ist Max Rychners wahre Begabung, und hier gelingt ihm Unvergeßliches. Vor allem Rudolf Borchardt und Walter Benjamin sieht man viel deutlicher vor sich. Borchardt, der nach einer großen Rede in privater Runde, eine Faust mit gebogenem Arm aufs Knie gestützt, bis morgens um drei sitzt, "aufrecht und nie sich zurücklehnend, schlagfertig in den Antworten, einen anwesenden Auchdichter elegant, unbetont und nebenbei seiner Unbildung und Geschmacklosigkeit überführend", Borchardt, der provenzalische Verse des Guillem von Poitiers fast ohne Stockung in altenglische Verse umwandelt und seiner schwangeren Frau auf einer Reise abends im Hotel zur Aufmunterung den "Tasso" vorträgt; auswendig, da das Buch nun leider nicht zur Hand ist.
Und Benjamin, der mit Bloch zusammentrifft und sich über Politik mit ihm zankt: "Die beiden wiesen diskutierend gegenseitig mit ihren Pfeifen aufeinander, wie mit Pistolen, die in verkehrter Richtung losgegangen waren und am falschen Ende rauchten. Benjamin hatte etwas heiter Hochgemutes an sich, während Blochs Gesicht blitzte und wetterte, wenn er angriff, wo der andere garnicht nötig fand, Truppen zu entfalten, auch darum, weil ihm keine zur Hand waren." Beeindruckend auch die Vignette seines ersten Zusammentreffens mit Benjamin, im Herbst 1931 in einem kleinen Berliner Restaurant Unter den Linden. Benjamin, schon lange verarmt zu dieser Epoche, zückt beim Verlassen des Lokals an der Kasse eine Brieftasche, die "beinahe wurstförmig vor Fülle an Geldscheinen" - "dann versank er in Träumerei, betrachtete sie längere Zeit versonnen und begann in den Banknoten zu blättern wie in einem Buch."
Für die verkehrten Pfeifen und diese Buchwurst, dieses Wurstbuch, in dem der versunkene Benjamin blättert, sei seinem Schilderer gedankt, schnödes Truppenentfalten eingestellt und der Herausgeber mit dem großen Lob bedacht, das seiner schönen Auswahl gebührt.
Max Rychner: "Bei mir laufen Fäden zusammen". Literarische Aufsätze, Kritiken, Briefe. Veröffentlichung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Herausgegeben von Roman Bucheli. Wallstein Verlag, Göttingen 1998. 422 S., geb., 48,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
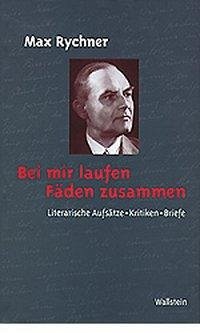





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.01.1999
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.01.1999