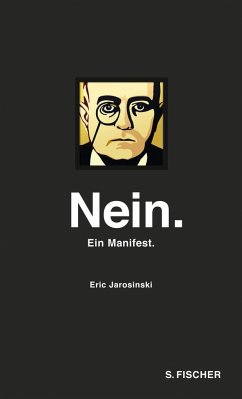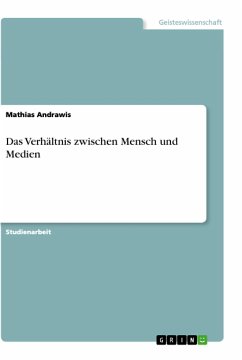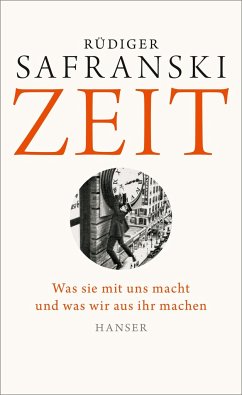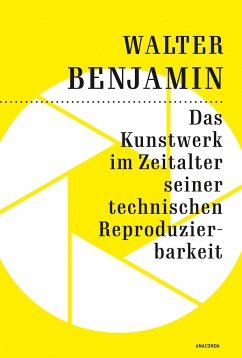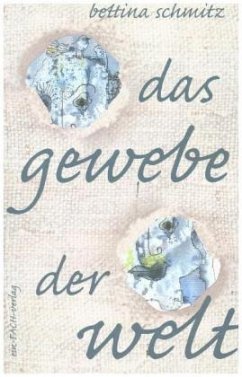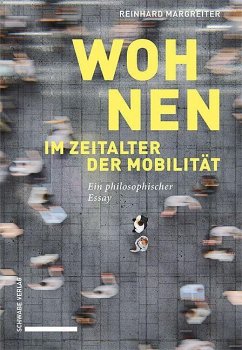Baggersee
Frühe Schriften aus dem Nachlass
Herausgegeben: Khaled-Lustig, Sandrina; Hron, Tania
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
42,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Baggersee versammelt frühe, unveröffentlichte Texte aus dem Nachlass Friedrich Kittlers. Die zwischen Mitte der 60er und Mitte der 70er Jahre verfassten Essays entstanden im Kontext neuer Freiräume. Am titelgebenden Baggersee, einer Kiesgrube bei Niederrimsingen in der Nähe Freiburgs, verbrachte Friedrich Kittler lange Sommer mit Schwimmen, Sonnen, Denken, Lesen, Diskutieren, Lieben und Grenzerfahrungen machen. Die Themenvielfalt der hier versammelten frühen Texte verdankt sich nicht zuletzt den Sommertagen am Baggersee. Die Essays kreisen um Gegenstände des Alltags, Lektüren, Reisebeob...
Baggersee versammelt frühe, unveröffentlichte Texte aus dem Nachlass Friedrich Kittlers. Die zwischen Mitte der 60er und Mitte der 70er Jahre verfassten Essays entstanden im Kontext neuer Freiräume. Am titelgebenden Baggersee, einer Kiesgrube bei Niederrimsingen in der Nähe Freiburgs, verbrachte Friedrich Kittler lange Sommer mit Schwimmen, Sonnen, Denken, Lesen, Diskutieren, Lieben und Grenzerfahrungen machen. Die Themenvielfalt der hier versammelten frühen Texte verdankt sich nicht zuletzt den Sommertagen am Baggersee. Die Essays kreisen um Gegenstände des Alltags, Lektüren, Reisebeobachtungen, Naturphänomene, Sinneswahrnehmungen, Körperfunktionen, Wiedergänger, Natur und Kultur, Tod und Leben. Friedrich Kittler schreibt über Haare, Tiere, Filme, Spielautomaten, Kreuzworträtsel, Spiegel, Popmusik, Technik, Rauchen, Rausch und Mode. Am Ende der Studentenbewegung war auch in Freiburg der Aufbruch zu einem neuen Denken spürbar. Das Bewusstsein einer Veränderung oder Krise eröffnete Raum für ein Schreiben, in dem Gedankengespinste, Beobachtungen, systematische Erörterungen und solitäre Einfälle zusammentreten.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.