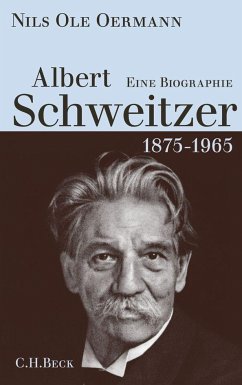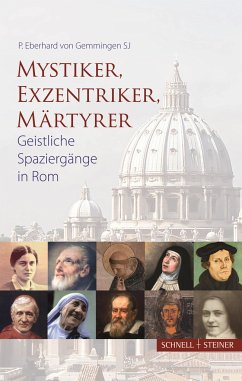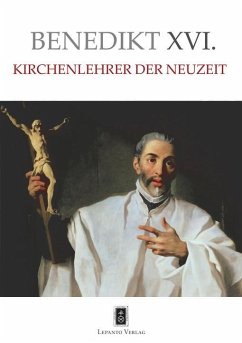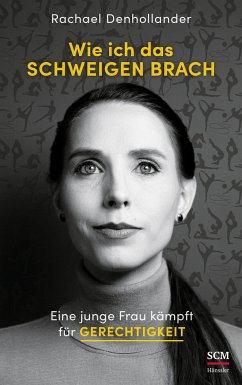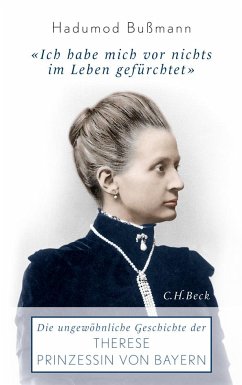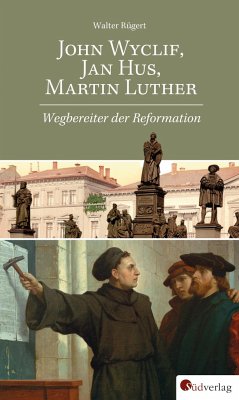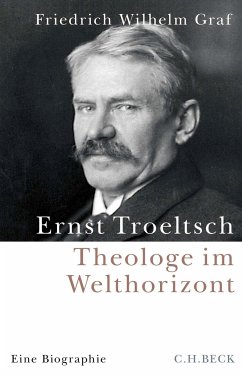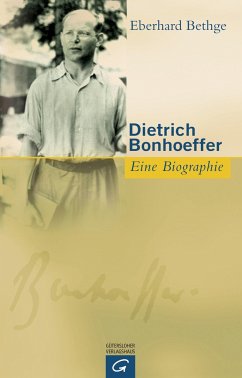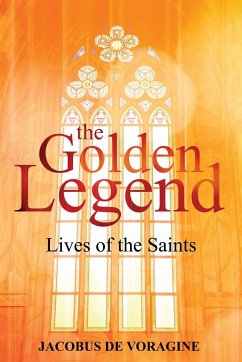Nicht lieferbar
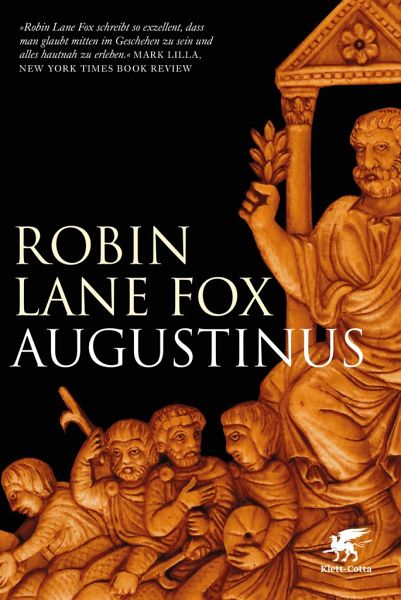
Augustinus
Bekenntnisse und Bekehrungen im Leben eines antiken Menschen
Übersetzung: Schuler, Karin; Schlatterer, Heike
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Mit großer Sprachkunst erzählt und deutet Robin Lane Fox die entscheidenden Lebensphasen des heiligen Augustinus. Einfühlsam porträtiert er den Menschen und genialen Denker, der Meisterwerke der Weltliteratur schuf. Zugleich lässt er die faszinierende geistige Welt der Spätantike lebendig werden.Augustinus von Hippo (354-430 n. Chr.), Redner, Philosoph und Kirchenlehrer, ist bis heute eine geistige Macht geblieben. Die Bürde des Schicksals und die Erfahrung der Freiheit, die Endlichkeit des Menschen und die Unendlichkeit Gottes - zwischen diesen Polen bewegt sich sein Leben.Robin Lane F...
Mit großer Sprachkunst erzählt und deutet Robin Lane Fox die entscheidenden Lebensphasen des heiligen Augustinus. Einfühlsam porträtiert er den Menschen und genialen Denker, der Meisterwerke der Weltliteratur schuf. Zugleich lässt er die faszinierende geistige Welt der Spätantike lebendig werden.
Augustinus von Hippo (354-430 n. Chr.), Redner, Philosoph und Kirchenlehrer, ist bis heute eine geistige Macht geblieben. Die Bürde des Schicksals und die Erfahrung der Freiheit, die Endlichkeit des Menschen und die Unendlichkeit Gottes - zwischen diesen Polen bewegt sich sein Leben.
Robin Lane Fox zeigt ihn als einen Mann des späten römischen Reiches, dessen Denken von Anfang an von den intellektuellen Debatten seiner Zeit tief geprägt war und der sich ständig neu erfand. Mit großem Einfühlungsvermögen und Scharfsinn erzählt er die packende Geschichte Augustinus' vielfältiger Wandlungen.
Anhand der »Bekenntnisse«, eines der größten autobiographischen Meisterwerke aller Zeiten, schildert der Historiker Leben, Charakter und Temperament einer ebenso leidenschaftlichen wie komplexen Persönlichkeit.
Augustinus von Hippo (354-430 n. Chr.), Redner, Philosoph und Kirchenlehrer, ist bis heute eine geistige Macht geblieben. Die Bürde des Schicksals und die Erfahrung der Freiheit, die Endlichkeit des Menschen und die Unendlichkeit Gottes - zwischen diesen Polen bewegt sich sein Leben.
Robin Lane Fox zeigt ihn als einen Mann des späten römischen Reiches, dessen Denken von Anfang an von den intellektuellen Debatten seiner Zeit tief geprägt war und der sich ständig neu erfand. Mit großem Einfühlungsvermögen und Scharfsinn erzählt er die packende Geschichte Augustinus' vielfältiger Wandlungen.
Anhand der »Bekenntnisse«, eines der größten autobiographischen Meisterwerke aller Zeiten, schildert der Historiker Leben, Charakter und Temperament einer ebenso leidenschaftlichen wie komplexen Persönlichkeit.