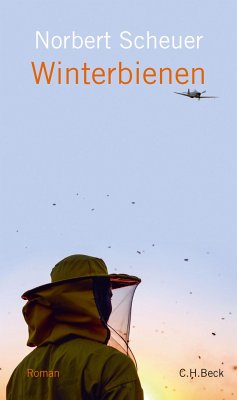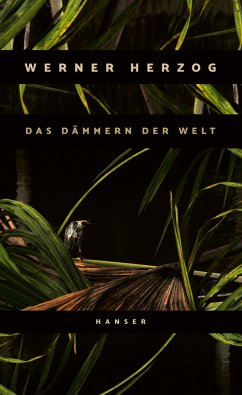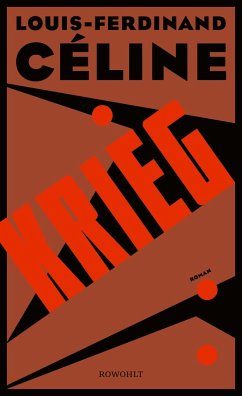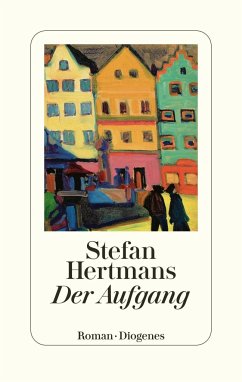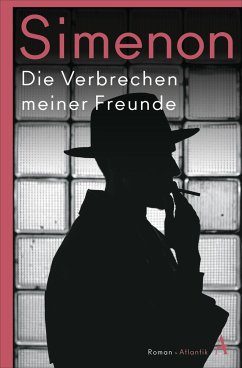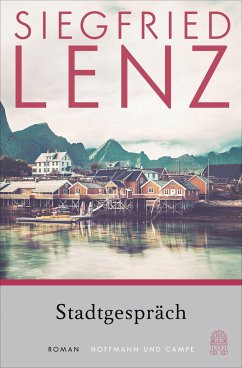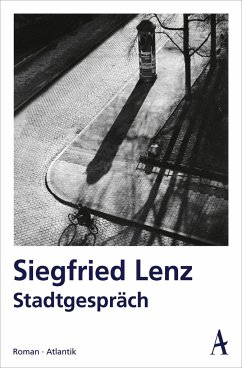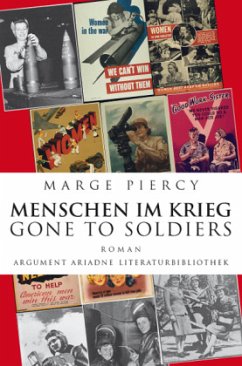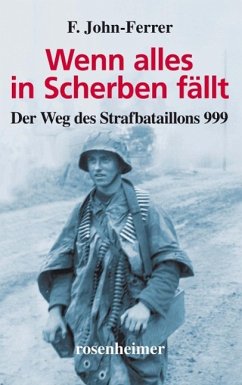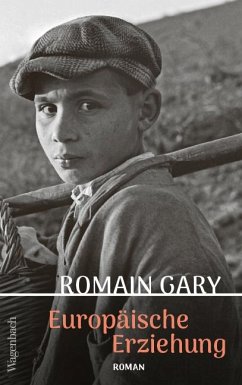von "Gracq d'avant Gracq", also gewissermaßen von einem Autor vor seiner eigentlichen Autorschaft. Das trifft allerdings nicht zu, denn erstens hatte Gracq schon 1938 seinen Roman "Auf Schloß Argol" publiziert, der Bretons Bewunderung fand, und zweitens sind die beiden Texte, um die es sich hier handelt, ganz und gar Julien Gracq.
In der drôle de guerre, jener Zeit zwischen Anfang September 1939 und dem 10. Mai 1940, als an der Westfront so gut wie gar nichts passierte, war das Surreale dem Wirklichen in ganz besonders hohem Maße immanent. Und ein geeigneterer Protokollant und Erzähler dieses Sachverhalts als Gracq lässt sich kaum denken. Protokollant ist er im ersten der beiden Texte, die beide irgendwann 1941/42 nach seiner Entlassung aus der deutschen Gefangenschaft (in Hoyerswerda) geschrieben wurden. "Erinnerungen an den Krieg" heißt der Text, und auf gut hundert Seiten führt Gracq hier gewissermaßen ein nachgeholtes Tagebuch, das am 10. Mai 1940 in dem Provinznest Winnezeele im französischen Flandern beginnt und am 2. Juni mit Gracqs Gefangennahme in einem Keller nahe Dünkirchen endet. Als Absolvent der ENS in der Rue d'Ulm hat Gracq automatisch Offiziersrang und führt als Leutnant einen Zug des 137. Infanterieregiments, der vor allem aus bretonischen Bauern besteht und im Übrigen gar nicht kampffähig ist: "Mein Zug ist nicht so bemannt, um ins Feld zu ziehen", heißt es gleich auf den ersten Seiten, denn er ist unterbesetzt, und die Unteroffiziere sind entweder "ausgesprochen feige und dumm" oder aber "sehr unzulänglich".
Der Auftrag der französischen Truppen, die damals reichlich ziellos durchs französische Flandern, durch Belgien und durch Holland ziehen, ist aber ohnehin unklar. Es fehlen Karten, niemand weiß genau, wo der Feind ist, und Befehle von oben kommen entweder gar nicht oder sind ungenau: "Eine Stunde später kommt der Befehl an den Zug B. und an meinen, die Brücke von Zycklin zu übernehmen. Wo befindet sich die Brücke von Zycklin? Seht, wie ihr zurechtkommt." In seinen Absurditäten und Unbestimmtheiten erinnert der Bericht von diesem komischen Krieg manchmal tatsächlich an das - ganz und gar fiktionale - Bändchen "Feinde" von Reinhard Lettau aus dem Jahr 1968.
Da Freund und Feind nicht immer zu unterscheiden sind, kommt es zu Vorfällen wie diesem: "Am Nachmittag ein langer Halt auf freiem Feld. Wir stellen sofort MGs zur Fliegerabwehr auf, und bald lasse ich auf Flugzeuge schießen, die im Tiefflug auf uns zukommen. Sie machen sofort kehrt und zeigen uns die Kokarden auf den Flügeln. Zum Glück haben wir keinen Schaden angerichtet. Aber als Richtschnur war uns gesagt, dass jedes Flugzeug, das unter 500 Meter Höhe fliegt, kein französisches sei."
Meistens passiert aber gar nichts. "Wir haben das Meisterstück vollbracht, zehn Tage im Zickzack durch das besetzte Holland und das besetzte Belgien zu marschieren, ohne einen Schuss abzufeuern." Oder, später: "Links das Häuschen des Bahnwärters. Rechts die Straße, die über das Gleis führt. Keine Spur des Krieges in all dem, bis auf die Telegraphenleitungen, die abgerissen an den Pfosten baumeln. Fast immer die erste Retusche, die die Granaten an der Landschaft vornehmen."
Manchmal ist der Feind sehr nah, man kann ihn reden hören, unter Umständen aber nicht sehen. Die hauptsächliche Beschäftigung aber ist das Warten dort, wo man sich eingegraben hat. "Totale Untätigkeit. Natürlich kommt es nicht in Frage, sein Loch ohne Begründung zu verlassen. Ich rauche, ich kaue an Grashalmen, ich schlafe meine Steaks aus. Nichts zu lesen." Dass Gracq "seine Steaks ausschläft", hängt damit zusammen, dass sie ihm als Offizier im Gegensatz zu den Mannschaftsdienstgraden zustehen, und eine doppelte Ration Wein dazu.
Trotz der harschen Bemerkungen über seine Unteroffiziere verachtet der Leutnant seine Leute jedoch nicht, ganz im Gegenteil: "Alle sind Bauern bis in die Fingerspitzen - für die ich heute Abend Achtung empfinde und die dem Krieg nicht mehr geben, als man ihm geben muss."
Und das ist möglichst wenig, denn: "Alles ist falsch, jeder spürt es, alles ist Schein, jeder tut ,als ob'. Imitiert die Gesten und die Befehle, die die Tradition einer ,heroischen Verteidigung' vorschreibt." Da alles Schein ist, da man über die eigene Lage nicht wirklich Bescheid weiß und jegliche Kohärenz fehlt, kristallisieren sich umso schärfer Bilder wie jenes der alten Frau in einem Café heraus, die selbst unter dem Beschuss der deutschen Artillerie zwei französischen Soldaten weiter seelenruhig Pernod einschenkt: "Ich werde einige Stunden später erfahren, dass ein Granatsplitter sie auf der Stelle getötet hat."
Bekanntlich unterrichtete Louis Porier, wie Gracq mit bürgerlichem Namen hieß, über drei Jahrzehnte lang an verschiedenen Gymnasien Geographie und Geschichte. In seinen Anfängen als Lehrer war das beinahe ein "Bindestrichfach", und in einem Gespräch mit Jean-Louis Tissier 1978 hat Gracq deutlich zu erkennen gegeben, dass es die Geographie und dass es die Landschaften waren, die ihn für diese Fächerkombination gewannen: "Der konkrete Aspekt der Geographie interessierte mich sehr. Ich hatte den Eindruck, etwas Ernsteres zu tun als meine Kameraden, die Literatur oder Philosophie studierten." Als Schriftsteller ist Gracq dann zum vielleicht größten Leser von Landschaften geworden, den es in der Literaturgeschichte gab, wie viele Passagen in den beiden Bänden der "Witterungen" und dann der Band "Der große Weg" bezeugen.
Aber all das war von Anfang an da, wie die Notizen aus dem Krieg jetzt zeigen, und es bewährt sich selbst an Landschaften, die kaum etwas herzugeben scheinen: "Die Polder. Die Polder von Saaftingen, ,die glückliche Halbinsel von Ossenise', wie es in der Dissertation von Blanchard heißt. Aber riesig, viel größer als in meiner Vorstellung, zwei bis drei Kilometer breit. Nichts als das Gras und die Deiche, Grasseen zwischen den Deichen - ein so dichtes, so gefräßiges Gras, dass es unter sich begräbt und beinahe erschreckt. Wir wandern im Zickzack auf der Krone der Deiche zwischen diesen für Titanen bemessenen Parzellen."
Die knapp siebzig Seiten lange Erzählung, die den zweiten Teil des Bandes bildet, setzt im Gegensatz zu den Erinnerungen erst am 23. Mai ein, verwandelt von dort an aber den Stoff der Notizen reichlich maßstabsgetreu in Fiktion. Protagonist ist der Leutnant G., erzählt wird in der dritten Person. Wer der Erzähler ist, wird nicht ganz klar; ein paar Mal nämlich taucht ganz unvermittelt im Text ein "wir" auf. Dafür gäbe es zweierlei Erklärungen: Entweder, was ich für unwahrscheinlich halte, der Erzähler ist einer aus Leutnant G.s Truppe, oder aber Gracq, der sich auf die zuerst geschriebenen Erinnerungen stützte, ist dieses "wir" (und einmal auch "uns") schlichtweg unterlaufen. Vermutlich hat er sich die beiden Schulhefte, in denen er die beiden Texte niederschrieb, später nie mehr angesehen.
Aus dem Erzählungsentwurf ist dann 1958 mit einer geographischen Verschiebung in die Ardennen die Erzählung "Ein Balkon im Wald" geworden: zunehmende Fiktionalisierung. Dennoch ist auch der hier vorliegende Text keine Fingerübung, sondern bereits ganz Gracq. Natürlich hat auch dieser Schriftsteller, der nicht unter ständigem Schreibzwang litt, eine Entwicklung durchgemacht, aber das war eine inhaltliche und formale: Gracq hat sich in seinen späteren Jahren ganz von der Fiktion abgewandt und uns so großartige Bücher wie "Die engen Wasser", die schon erwähnten "Witterungen" und "Der große Weg" geschenkt. Die Mittel aber waren offenbar von vornherein im vollen Umfang da. Deshalb kann man auf die Frage, was man denn von diesem einzigartigen Autor lesen solle, eine ganz einfache Antwort geben: alles.
JOCHEN SCHIMMANG
Julien Gracq: "Aufzeichnungen aus dem Krieg".
Aus dem Französischen von Dieter Hornig. Droschl Verlag, Graz 2013. 190 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.02.2013
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 28.02.2013