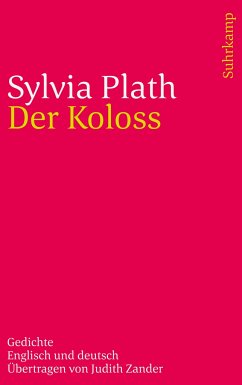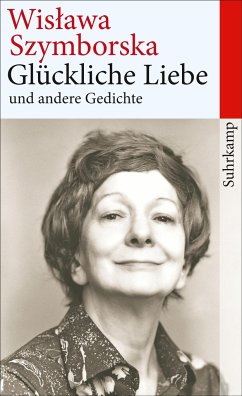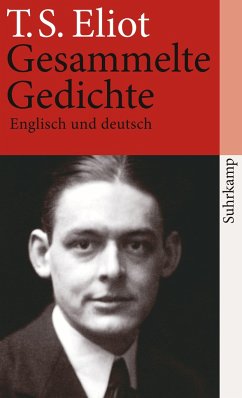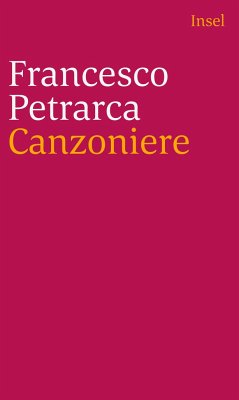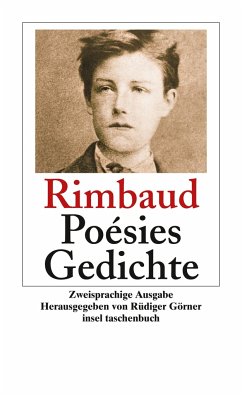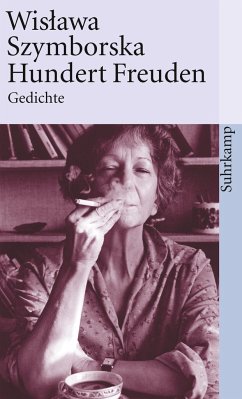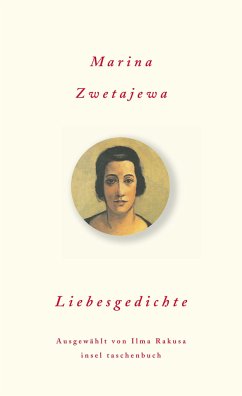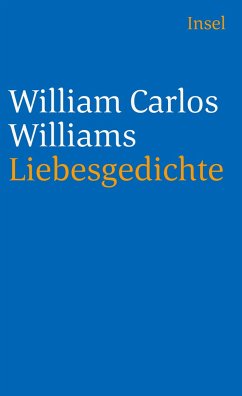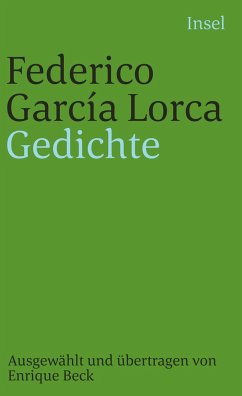Broschiertes Buch
Atlas der neuen Poesie
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar





Eine Weltkarte der heutigen Poesie, das wohl umfassendste Lyrik-Unternehmen der Gegenwart: der "Atlas der neuen Poesie". Er präsentiert Lyriker und Lyrikerinnen aus 36 Ländern und 22 Sprachen. Neben den Übersetzungen stehen die Originaltexte, damit der Leser auch der Melodie des Originaltextes nachgehen kann.
Joachim Sartorius, geboren 1946, wuchs in Tunis auf und lebt heute - nach langen Aufenthalten in New York, Istanbul und Nicosia - in Berlin. Seit 2001 leitet er die Berliner Festspiele. Sein lyrisches Werk wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Er veröffentlichte mehrere, in Zusammenarbeit mit Künstlern entstandene Bücher und ist Herausgeber der Werkausgaben von Malcolm Lowry und William Carlos Williams sowie verschiedener Anthologien. Auszeichnung 1998 für seine Übersetzung amerikanischer Lyrik von John Ashbery und Wallace Stevens mit dem Paul-Scheerbart-Preis sowie mit zahlreichen Stipendien ausgezeichnet.
Produktdetails
- rororo Taschenbücher 13978
- Verlag: Rowohlt TB.
- Artikelnr. des Verlages: 1501
- 1. Auflage
- Erscheinungstermin: 1. November 1996
- Deutsch
- Abmessung: 233mm x 159mm x 24mm
- Gewicht: 528g
- ISBN-13: 9783499139789
- ISBN-10: 3499139782
- Artikelnr.: 06479990
Herstellerkennzeichnung
ROWOHLT Taschenbuch Verlag
Kirchenallee 19
20099 Hamburg
info@bod.de
+49 (040) 7272-0
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.04.1995
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.04.1995Verzeiht mir, ihr Götter, diese Phrasen
Was bleibt nach dem häßlichen Ende der Welt: Joachim Sartorius gibt uns den "Atlas der neuen Poesie" / Von Heinrich Detering
Kennt noch jemand dieses Kindheitsgefühl, krank im Bett zu liegen und, fern der Schule und mit sich allein, im Atlas zu blättern? Sich festzulesen in unbekannten Zeichen, fremden Küstenlinien zu folgen, Namen nachzuhängen, die Geheimnisse verheißen? "Diercke" hieß das grundsolide, tief vernünftige Bilderbuch, das die ausschweifendsten Phantasiereisen beflügelte. Ausgerechnet die Poesie war es dann, die wenig später dem Pubertierenden solche Flausen austrieb. "Reisen" hieß das Gedicht, Gottfried Benn der Verfasser, und es begann mit der schnödesten
Was bleibt nach dem häßlichen Ende der Welt: Joachim Sartorius gibt uns den "Atlas der neuen Poesie" / Von Heinrich Detering
Kennt noch jemand dieses Kindheitsgefühl, krank im Bett zu liegen und, fern der Schule und mit sich allein, im Atlas zu blättern? Sich festzulesen in unbekannten Zeichen, fremden Küstenlinien zu folgen, Namen nachzuhängen, die Geheimnisse verheißen? "Diercke" hieß das grundsolide, tief vernünftige Bilderbuch, das die ausschweifendsten Phantasiereisen beflügelte. Ausgerechnet die Poesie war es dann, die wenig später dem Pubertierenden solche Flausen austrieb. "Reisen" hieß das Gedicht, Gottfried Benn der Verfasser, und es begann mit der schnödesten
Mehr anzeigen
Anfrage: "Meinen Sie, Zürich zum Beispiel / sei eine tiefere Stadt, / wo man Wunder und Weihen / immer als Inhalt hat?"
Wer sich an Dierckes kleine Verheißungen und Verlockungen gewöhnt hatte, mußte sich umgewöhnen, dem ennui ins trübe Auge blicken und modern werden. Nach der Reise um die Welt aber läßt sich womöglich ein Hintereingang ins Paradies finden. Und siehe da, hier liegt er vor uns, abermals in Gestalt eines Atlas, und über dem Tor steht diesmal der Name "Sartorius". "Atlas der neuen Poesie" heißt der genregemäß stattliche Band, und wer sich hier nicht träumenden Auges festliest, muß für die Poesie verloren sein. Durch einzelne Lyrikseiten in der "taz" jahrelang vorbereitet, zeigt nun der zwischen zwei Buchdeckeln gesammelte Atlas die Erträge der poetischen Weltstreifzüge eines Kenners.
Der erste Eindruck ist der eines überwältigenden Reichtums, einer üppigen Vielfalt und Qualität von Texten, lauter Einladungen zu phantastischen Reisen an die Ränder der Sprache und in fremde Zeichenwelten. Denn da alle übersetzten Gedichte parallel in der Originalsprache abgedruckt sind, darf der Blick an finnischen und albanischen Satzperioden entlangwandern, chinesische, kyrillische und arabische Schriftzüge nachzeichnen. Ein topographisches Raster gibt das einzige Einteilungskriterium ab: die Meridiane. An ihnen entlang werden 65 Dichter mit zumeist mehreren Texten aufgesucht; und so einmal um den Erdball. Eine Reise um die Welt, in neun "Mappen": ein Atlas der Musen. Die offenkundige Willkür dieser Anordnung, die sich von der thematischen Gliederung in Enzensbergers "Museum" und dem chronologischen Prinzip in Harald Hartungs unwiederholbar schöner "Luftfracht" demonstrativ absetzt, soll die einzelnen vor dem Allgemeinen sichtbar machen: Text geht vor Thema, Dichter vor Nationalliteratur. Keine Sammlung von Stimmen der Völker in Liedern soll hier präsentiert werden, eher ein Westöstlicher Diwan.
Die kommentierenden Noten und die programmatische Abhandlung, in denen der Herausgeber seine Auswahl überschaut, sind, bei aller Umsicht und erklärten Subjektivität, in einem Punkt doch unerbittlich: der Neuheit dieser "neuen Poesie". Das beginnt bei der Auswahl der Autoren. "Zwei Vorlieben", versichert Sartorius, hätten ihn geleitet, "die Vorliebe für die Jüngeren und die Vorliebe für die Unbekannten." Denn: "Das Prinzip der Entdeckung war wichtiger als das Prinzip der Hommage. Einzige Ausnahme bildet Hans Magnus Enzensberger selbst"; eine "Reverenz" an den Museumsgründer.
Nun soll nicht bestritten werden, daß der Kartograph sich erhebliche Verdienste als Entdeckungsreisender erworben hat. Aber nicht wenige seiner Schatzinseln verzeichnet mittlerweile und glücklicherweise schon unser Schulatlas. Oder sollten Jürgen Becker, Durs Grünbein, Friederike Mayröcker hierzulande nur Ortskundigen geläufig sein? Auch Elizabeth Bishop und Charles Simic, Mircea Dinescu und Bei Dao, Inger Christensen, Cees Nooteboom, Breyten Breytenbach und Andrea Zanzotto sind doch wohl auch bei uns längst als die modernen Klassiker angesehen, als die sie in ihren Heimatliteraturen gelten (was abermals nicht zuletzt Hartungs Vorgänger-Sammlung zu danken ist). Und zu "den Jüngeren" würde man schon rein arithmetisch die wenigsten zählen; immerhin beträgt das Durchschnittsalter der hier versammelten Dichter sechzig Jahre. Das ist überhaupt kein Einwand gegen die Auswahl, allenfalls einer gegen die Ankündigung, die mehr verspricht, als man halten kann - wer wollte sich schon eine Anthologie der Weltpoesie zutrauen, die überwiegend aus Texten junger und unbekannter Dichter bestünde?
Neuigkeit als Grundwert aber bestimmt auch einen zweiten Leitgedanken: daß wir mit den folgenden Texten in einen "Sturm aufflackernder Signale" gerieten, einen Blizzard der Vielfalt. Von neuer "Unübersichtlichkeit" ist da die Rede und "vom Zerfall der einstigen ,Weltsprache der Poesie' in zahllose Sprachen und Sprechweisen". Wiederholter Lektüre muß das als Phantom erscheinen. Im Gegenteil frappiert im Ganzen dieser Sammlung nichts so sehr wie der Eindruck: hier kennen sich alle. So unberechenbar die Einzelgänger durch die topographischen Ordnungen vagabundieren, so verwandt und verschwägert scheint jeder mit jedem, eine weitverzweigte, aber durchaus überschaubare Familie der Weltpoesie.
Friederike Mayröcker zum Beispiel (Seite 221) schreibt ein deutsches Gedicht auf ein dänisches Gedicht von Inger Christensen (Seite 228) und ein zweites "für Andrea Zanzotto", der wiederum zwischen den beiden mit eigenen Gedichten vertreten ist, die unter anderem von Peter Waterhouse übersetzt worden sind, der bald darauf selbst als Dichter in Erscheinung tritt. Ilya Kutik, Rußland, schreibt Gedichte "Nach Tomas Tranströmer" und "Nach Lars Gustafsson", Schweden, und der Schweizer Felix Philipp Ingold, der diese Texte ins Deutsche übersetzt, kommt später seinerseits als Lyriker zu Wort, und zwar (wie vor ihm Paul Wühr) mit einem Text über Hölderlin und einem weiteren "für E. J.", der zuvor bereits als Ernst Jandl Gedichte von Christopher Middleton übersetzt hat. Man kennt sich, und man ist per du. Enzensberger schreibt "für Günter", Charles Simic "für Octavio"; das hat dann wieder Enzensberger übersetzt. ("In der Bibliothek" heißt das Gedicht passenderweise.) Und es sind wohlgemerkt allesamt gelungene, manchmal bewegende Texte, die da zwischen den Duzfreunden und Hausnachbarn ausgetauscht werden.
Nicht nur vertraulich geht es da zu, sondern intim. "Wann immer ich John Ashbery fragte, welche Dichter der ihm nachfolgenden Generation er besonders schätze, so nannte er (. . .) stets James Tate." So und ähnlich ist es in den begründenden Anmerkungen des Herausgebers öfter zu lesen. "Wer Paul Wühr nachts in seiner alten Münchner Wohnung am Elisabethmarkt Hölderlin auswendig hat hersagen hören, weiß intuitiv von seinem Umgang mit Sprache." Und selbst wer nie dabei war, wie Joachim Sartorius nachts Paul Wühr beim Aufsagen Hölderlins zuhörte, weiß intuitiv, was hier gemeint ist. Sie stehen sich alle irgendwie nahe, die Dichter und Leser, die Schriften und die Stimme, und tauschen oft die Plätze; sie sind enger zusammengerückt, die Bewohner des Museums der modernen Poesie, sie lesen einander vor und sagen auf. Und es ist ein schönes und stilles Vergnügen, den Unterhaltungen dieser poetischen Ausgewanderten lesend beizuwohnen.
Statt der annoncierten babylonischen Sprachverwirrung erleben wir darum kleine lyrische Pfingstwunder. Exilierte und Flüchtlinge (die noch einer isolierten "Nationalkultur" zugehörig sind), Weltwanderer und Seßhafte verbindet ein weltliterarischer Synkretismus, der Orte und Zeiten überspringt. Der im Berliner Exil lebende chinesische Dichter Duo Duo schreibt Verse "zum Gedenken an Sylvia Plath". Shuntaro Tanikawa widmet ein Gedicht Paul Klee, ein anderes Johann Sebastian Bach; darauf antworten, in Sartorius' umsichtigem Arrangement, Cees Nootebooms wunderbare Zeilen nach Texten des japanischen Haiku-Meisters Bashô. Amanda Aizpuriete, Übersetzerin Mandelstams und Bachmanns, schreibt lettische Verse über arabische Dichtungen. Und der Pole Ryszard Krynicki erkennt, daß in den Kasernen, an denen er als Schulkind immer vorbeigelaufen ist, "während des Krieges der Dichter / Gottfried Benn als Militärarzt gearbeitet hatte". "Weltsprache der modernen Poesie" lautete der vielzitierte und oft bestrittene Schlüsselbegriff in Enzensberger Museumsführung. Nie war er so wertvoll wie heute. Sartorius' Auswahl zeigt, was seine Einleitung leugnen will: Die Weltsprache der Poesie hat sich stabilisiert, und die meisten ihrer Mundarten, Sprechweisen, Soziolekte gehen uns erstaunlich vertraut ins Ohr.
Zum Vertrauten gehört auch, daß diese poetische Weltsprache sich gern und oft über sich selbst Gedanken macht. Die enger zusammengerückten Poeten vergewissern sich gemeinsam ihrer gemeinsamen Sache. Les Murray erklärt in einem Gedicht, was "Ein Gedicht kann . . .", Makoto Ooka in einem anderen, was "In einem Gedicht ist . . .", und Roberto Juarroz sagt, was "Jedes Gedicht macht . . . ". Eliso Diego weiß: "Ein Gedicht ist nicht mehr als . . .", und Enzensberger schreibt "Gedichte für die Gedichte nicht lesen". John Ashbery eröffnet ein Gedicht mit der Erklärung: "Dieses Gedicht befaßt sich mit Sprache auf einer sehr einfachen Ebene", während ein Text von Michael Palmer skeptisch bleibt: "Kein Text ergibt irgendeinen Sinn". Und so fort in einer langen Kette poetologischer Selbstbestimmungen - jede Fata Morgana ein déjà-vu.
Natürlich liegen einzelne oder kleine Gruppen hier weit abseits von dieser europäisch-amerikanisch-fernöstlichen Gegend, Gedichte arabischer und afrikanischer Dichter vor allem. Da spätestens endet auch der exotische Reiz der fremden Sprachen und weicht der ernüchternden Feststellung, wie vieles doch im Original verständlich ist. Fast schon hatte man es natürlich gefunden, daß etwa afrikanische Autoren in englischer oder französischer Sprache schreiben. Hier erst, zum Beispiel neben dem eigensinnigen Lettisch der Amanda Aizpuriete, werden diese Sprachwunden kolonialer Landnahmen wieder als Skandalon wahrnehmbar. Bezeichnenderweise sind es denn auch allein einige dieser afrikanischen Poeten, die intensiv nach volksliterarischen Wurzeln suchen: der Algerier Kateb Yacine etwa in Volkslied-Sammlungen unter den Berbern, der Ghanaer Kofi Nyidevu Awoonor in Zeremonialtexten seiner Heimat. "Wir grüßen das von der Sintflut errettete Afrika", schreibt der im französischen Exil lebende Marokkaner Abdellatif Laâbi, "ich danke dir Europa daß du mich unter dem Banner deiner rationalen und universellen Sprachen / vereint hast." Das verstörend grelle, aggressive Langgedicht "Die elektronischen Affen", das sich so präsentiert, gerät zu einem der fremdesten Texte dieser Sammlung. Hier flackert wirklich etwas auf von den unheimlichen Leuchtfeuern, die Sartorius im Vorwort beschwört. Kein Pathos der négritude mehr, nicht einmal ein emanzipatorischer Wegweiser, nur ein zerfetztes Textmonstrum, dessen Bruchkanten noch immer schneiden.
Gedichte wie dieses erregen in ihrer Maß- und Rücksichtslosigkeit tiefer als die cleverste language poetry amerikanischer Gegenwartspoeten. Aber wehe dem, den es da nach Ethno-Romantik verlangt, und selig die Literaturen, deren Umstände solche Texte nicht mehr fordern, die Muße haben und frei sind für das zierliche Pingpong zwischen Haikus und Terzinen.
Bei aller Vertrautheit aber wäre hier doch nichts abwegiger als eine Wiederholung der schon mehrfach ausgedienten Rede vom Ende der modernen Poesie. Woher denn? Das Gedicht hat sich keineswegs erledigt, es lebt und gedeiht. Aber es scheint so, als habe es seine Mittel und Möglichkeiten ziemlich vollständig entfaltet. So wie hier Sonette in allen möglichen Varianten zu lesen sind, einmal sogar Stanzen (versteht sich: immer als zitierte und gebrochene Formen), so erscheinen auch die reimlosen und freien Verse, die meditativen Tanka-Strophen und die erzählenden Gedichte, die "lyrischen" und die prosaischen, die agitierenden und die kontemplativen Texte, die konstruktiven "Systemdichtungen" und die aleatorisch-assoziativen Sprachspiele allesamt als heterogene und doch schön gefügte Teile eines großen, angenehm bunten Fächers; neben-, aber keineswegs gegeneinander, formenreich und spannungsarm, Exempla eines modernistischen Klassizismus wider Willen.
Und selbst wenn man die neuen Avantgardisten hinzunähme, auf die Sartorius weitgehend verzichtet, also etwa Thomas Kling statt Durs Grünbein, der Befund würde sich nicht ändern: die da gespielten Instrumente sind selbst schon ein paar Generationen alt und klingen darum, gut gestimmt wie bei Kling, so altmeisterlich schrill wie eine dadaistische Stradivari.
Als neuartige Tendenzen erwägt der Herausgeber das Festhalten vieler Dichter an einer appellativ-politischen Wirkungsabsicht des Gedichts, das Beharren anderer auf seinem "metaphysischen Charakter", schließlich das Vergnügen einer dritten Gruppe am poetischen Sprachspiel. Ja, so ist es wohl. Aber so ist es auch in poetologischen Texten seit dem späten neunzehnten Jahrhundert immer wieder zu lesen. Wenige Texte dieser Sammlung entkommen den Mustern und Modellen, die eine seither entwickelte und immer verfeinerte Moderne ihnen bereitstellt. Aber warum sollten sie auch?
Vermutlich sollen sie bloß, weil lyrische Dichtung, spätestens seit sie sich selbst als "modern" bestimmt, die permanente Innovation verinnerlicht hat wie einen Walzerrhythmus; ihre einzig verbindliche und verläßliche Tradition war immer der Traditionsbruch. "Etre absolument moderne", das hieß vor allem: nichts nochmal tun. Die Entautomatisierung unseres Sprechens und Denkens, die Wiedereröffnung unserer Sinne, die sich das "Projekt" (J. Habermas) einer ästhetischen Moderne vor rund einem Jahrhundert vorgesetzt hatte, könnte selbst automatisch geworden sein. Der einfachste und menschenfreundlichste Gedanke einer undramatischen Postmoderne wäre vielleicht: den kategorischen Innovationsimperativ aufzugeben. Die immerwährende Revolution der Künste, in weiten literarischen Landstrichen schon abgeblasen, dauert in einigen unbeugsamen Dörfern noch an. Eines dieser Dörfer sind der Titel und die Einleitung dieser Sammlung. Auch wenn uns viele dieser Texte ganz neu sind, ihre Poesie ist es nicht. Schön so.
Natürlich gibt es auch diesseits von Afrika poetische Sprachen, die ungehört und unerhört sind. Einen engagierten Hermetismus etwa, der die poetische Gegen-Rede im Angesicht der Bildschirme abermals steigert, der babylonische Elfenbeintürme von beträchtlicher Höhe errichtet. Oder die unkalkulierbaren Wunder der Unschuld, die jederzeit plötzlich geschehen können und uns hier zum Beispiel in der "Widmung" der Olga Sedakowa zuteil werden.
Und dann gibt es natürlich jene mächtige Strömung, die sich in die hier kartographierten Landschaften längst schon eingeschnitten hat, sie wässert und sich auch aus ihren Bächen speist, die aber in solchen Atlanten seltsamerweise noch immer nicht vorkommt. Die Rede ist, pars pro toto, von Bob Dylan. Nicht von dem, der nach landläufiger Gönnermeinung doch "eigentlich" ein Lyriker sei, im etwas peinlichen Pop-Gewand, sondern von dem erklärten "song and dance man", dem "performing artist", und der längst Weltkunst gewordenen oralen Kultur, die er resümiert und repräsentiert. Natürlich, Dylans Songs haben schon als Texte eminent poetische Qualitäten. Aber dann ist da eben auch diese Überfülle von Klängen, Phrasierungen, Songmustern unterschiedlichster anglo-amerikanischen Traditionen vom Blues bis zur Filmmusik, von Chuck Berry bis zu Sam Shepard. Und dann und vor allem ist da die Präsenz der Stimme, die Inszenierung und Zufälligkeit des Augenblicks, den die Schallplatte festhält.
Das ist Klang- und Wortkunst einer eigenen Tradition, gleich weit entfernt von poetry wie von Partituren, und mit beiden doch verschwistert. Dylans bisher letzte Alben enthalten keine neuen Songs mehr, sondern blicken aus der Ära der Videoclips zurück auf die eigene Tradition, hinter die eigenen Anfänge zurück bis ins 19. Jahrhundert: Museen einer Moderne, die bei Sartorius und Hartung sowenig vorkommt wie in Enzensbergers Grund- und Musterbuch.
Dabei tun sie, Wand an Wand und ohne voneinander viel Notiz zu nehmen, dieselbe Arbeit. Zwar überschreitet, was sich zwischen den ersten blue notes und Dylans archäologischer Rückwendung vollzogen hat, die Grenzen der Schriftkultur, deren Archen hier vor Anker liegen. Aber die Archenbauer und die Archäologen haben längst mehr gemeinsam, als sie trennt. Tatsächlich zeigt Sartorius' Sammlung am deutlichsten jenen konservativen Grundzug, der schon die chronologische Anlage in Hartungs "Luftfracht" bestimmte und den Enzensbergers "Museum" ironisch im Titel führte. Präzise gibt er sich da zu erkennen, wo der Schlußsatz des Enzensbergerschen Einleitungsessays wieder aufgegriffen wird. Der hatte 1960 gelautet: "Auch die moderne, wie jede Poesie, spricht von etwas, spricht aus, was uns betrifft." Sartorius 1995 vernimmt "diese Stimmen von außen, die . . . zum Bewahren dessen führen, was uns betrifft, das könnte die Poesie sein".
Bewahren, das ist's. Die Stimmen drohen zu verstummen; was uns betraf, verschwindet; die Welt geht häßlich zu Ende. Schön, daß es Anthologisten gibt, die ihre Archen zimmern für eine in Altersschönheit strahlende neue Poesie und ihre Urheber. Das letzte Wort habe darum Stefán Hördur Grímsson, der isländische Heringsfänger und Dichter: "Verzeiht mir ihr Götter diese wiedergekäuten Phrasen der Illustrierten. / Lobt Gott, das Gedicht und die Liebe / bis zuallerletzt."
Joachim Sartorius (Hrsg.): "Atlas der neuen Poesie". Rowohlt Verlag, Reinbek 1995. 352 S., geb., 48,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Wer sich an Dierckes kleine Verheißungen und Verlockungen gewöhnt hatte, mußte sich umgewöhnen, dem ennui ins trübe Auge blicken und modern werden. Nach der Reise um die Welt aber läßt sich womöglich ein Hintereingang ins Paradies finden. Und siehe da, hier liegt er vor uns, abermals in Gestalt eines Atlas, und über dem Tor steht diesmal der Name "Sartorius". "Atlas der neuen Poesie" heißt der genregemäß stattliche Band, und wer sich hier nicht träumenden Auges festliest, muß für die Poesie verloren sein. Durch einzelne Lyrikseiten in der "taz" jahrelang vorbereitet, zeigt nun der zwischen zwei Buchdeckeln gesammelte Atlas die Erträge der poetischen Weltstreifzüge eines Kenners.
Der erste Eindruck ist der eines überwältigenden Reichtums, einer üppigen Vielfalt und Qualität von Texten, lauter Einladungen zu phantastischen Reisen an die Ränder der Sprache und in fremde Zeichenwelten. Denn da alle übersetzten Gedichte parallel in der Originalsprache abgedruckt sind, darf der Blick an finnischen und albanischen Satzperioden entlangwandern, chinesische, kyrillische und arabische Schriftzüge nachzeichnen. Ein topographisches Raster gibt das einzige Einteilungskriterium ab: die Meridiane. An ihnen entlang werden 65 Dichter mit zumeist mehreren Texten aufgesucht; und so einmal um den Erdball. Eine Reise um die Welt, in neun "Mappen": ein Atlas der Musen. Die offenkundige Willkür dieser Anordnung, die sich von der thematischen Gliederung in Enzensbergers "Museum" und dem chronologischen Prinzip in Harald Hartungs unwiederholbar schöner "Luftfracht" demonstrativ absetzt, soll die einzelnen vor dem Allgemeinen sichtbar machen: Text geht vor Thema, Dichter vor Nationalliteratur. Keine Sammlung von Stimmen der Völker in Liedern soll hier präsentiert werden, eher ein Westöstlicher Diwan.
Die kommentierenden Noten und die programmatische Abhandlung, in denen der Herausgeber seine Auswahl überschaut, sind, bei aller Umsicht und erklärten Subjektivität, in einem Punkt doch unerbittlich: der Neuheit dieser "neuen Poesie". Das beginnt bei der Auswahl der Autoren. "Zwei Vorlieben", versichert Sartorius, hätten ihn geleitet, "die Vorliebe für die Jüngeren und die Vorliebe für die Unbekannten." Denn: "Das Prinzip der Entdeckung war wichtiger als das Prinzip der Hommage. Einzige Ausnahme bildet Hans Magnus Enzensberger selbst"; eine "Reverenz" an den Museumsgründer.
Nun soll nicht bestritten werden, daß der Kartograph sich erhebliche Verdienste als Entdeckungsreisender erworben hat. Aber nicht wenige seiner Schatzinseln verzeichnet mittlerweile und glücklicherweise schon unser Schulatlas. Oder sollten Jürgen Becker, Durs Grünbein, Friederike Mayröcker hierzulande nur Ortskundigen geläufig sein? Auch Elizabeth Bishop und Charles Simic, Mircea Dinescu und Bei Dao, Inger Christensen, Cees Nooteboom, Breyten Breytenbach und Andrea Zanzotto sind doch wohl auch bei uns längst als die modernen Klassiker angesehen, als die sie in ihren Heimatliteraturen gelten (was abermals nicht zuletzt Hartungs Vorgänger-Sammlung zu danken ist). Und zu "den Jüngeren" würde man schon rein arithmetisch die wenigsten zählen; immerhin beträgt das Durchschnittsalter der hier versammelten Dichter sechzig Jahre. Das ist überhaupt kein Einwand gegen die Auswahl, allenfalls einer gegen die Ankündigung, die mehr verspricht, als man halten kann - wer wollte sich schon eine Anthologie der Weltpoesie zutrauen, die überwiegend aus Texten junger und unbekannter Dichter bestünde?
Neuigkeit als Grundwert aber bestimmt auch einen zweiten Leitgedanken: daß wir mit den folgenden Texten in einen "Sturm aufflackernder Signale" gerieten, einen Blizzard der Vielfalt. Von neuer "Unübersichtlichkeit" ist da die Rede und "vom Zerfall der einstigen ,Weltsprache der Poesie' in zahllose Sprachen und Sprechweisen". Wiederholter Lektüre muß das als Phantom erscheinen. Im Gegenteil frappiert im Ganzen dieser Sammlung nichts so sehr wie der Eindruck: hier kennen sich alle. So unberechenbar die Einzelgänger durch die topographischen Ordnungen vagabundieren, so verwandt und verschwägert scheint jeder mit jedem, eine weitverzweigte, aber durchaus überschaubare Familie der Weltpoesie.
Friederike Mayröcker zum Beispiel (Seite 221) schreibt ein deutsches Gedicht auf ein dänisches Gedicht von Inger Christensen (Seite 228) und ein zweites "für Andrea Zanzotto", der wiederum zwischen den beiden mit eigenen Gedichten vertreten ist, die unter anderem von Peter Waterhouse übersetzt worden sind, der bald darauf selbst als Dichter in Erscheinung tritt. Ilya Kutik, Rußland, schreibt Gedichte "Nach Tomas Tranströmer" und "Nach Lars Gustafsson", Schweden, und der Schweizer Felix Philipp Ingold, der diese Texte ins Deutsche übersetzt, kommt später seinerseits als Lyriker zu Wort, und zwar (wie vor ihm Paul Wühr) mit einem Text über Hölderlin und einem weiteren "für E. J.", der zuvor bereits als Ernst Jandl Gedichte von Christopher Middleton übersetzt hat. Man kennt sich, und man ist per du. Enzensberger schreibt "für Günter", Charles Simic "für Octavio"; das hat dann wieder Enzensberger übersetzt. ("In der Bibliothek" heißt das Gedicht passenderweise.) Und es sind wohlgemerkt allesamt gelungene, manchmal bewegende Texte, die da zwischen den Duzfreunden und Hausnachbarn ausgetauscht werden.
Nicht nur vertraulich geht es da zu, sondern intim. "Wann immer ich John Ashbery fragte, welche Dichter der ihm nachfolgenden Generation er besonders schätze, so nannte er (. . .) stets James Tate." So und ähnlich ist es in den begründenden Anmerkungen des Herausgebers öfter zu lesen. "Wer Paul Wühr nachts in seiner alten Münchner Wohnung am Elisabethmarkt Hölderlin auswendig hat hersagen hören, weiß intuitiv von seinem Umgang mit Sprache." Und selbst wer nie dabei war, wie Joachim Sartorius nachts Paul Wühr beim Aufsagen Hölderlins zuhörte, weiß intuitiv, was hier gemeint ist. Sie stehen sich alle irgendwie nahe, die Dichter und Leser, die Schriften und die Stimme, und tauschen oft die Plätze; sie sind enger zusammengerückt, die Bewohner des Museums der modernen Poesie, sie lesen einander vor und sagen auf. Und es ist ein schönes und stilles Vergnügen, den Unterhaltungen dieser poetischen Ausgewanderten lesend beizuwohnen.
Statt der annoncierten babylonischen Sprachverwirrung erleben wir darum kleine lyrische Pfingstwunder. Exilierte und Flüchtlinge (die noch einer isolierten "Nationalkultur" zugehörig sind), Weltwanderer und Seßhafte verbindet ein weltliterarischer Synkretismus, der Orte und Zeiten überspringt. Der im Berliner Exil lebende chinesische Dichter Duo Duo schreibt Verse "zum Gedenken an Sylvia Plath". Shuntaro Tanikawa widmet ein Gedicht Paul Klee, ein anderes Johann Sebastian Bach; darauf antworten, in Sartorius' umsichtigem Arrangement, Cees Nootebooms wunderbare Zeilen nach Texten des japanischen Haiku-Meisters Bashô. Amanda Aizpuriete, Übersetzerin Mandelstams und Bachmanns, schreibt lettische Verse über arabische Dichtungen. Und der Pole Ryszard Krynicki erkennt, daß in den Kasernen, an denen er als Schulkind immer vorbeigelaufen ist, "während des Krieges der Dichter / Gottfried Benn als Militärarzt gearbeitet hatte". "Weltsprache der modernen Poesie" lautete der vielzitierte und oft bestrittene Schlüsselbegriff in Enzensberger Museumsführung. Nie war er so wertvoll wie heute. Sartorius' Auswahl zeigt, was seine Einleitung leugnen will: Die Weltsprache der Poesie hat sich stabilisiert, und die meisten ihrer Mundarten, Sprechweisen, Soziolekte gehen uns erstaunlich vertraut ins Ohr.
Zum Vertrauten gehört auch, daß diese poetische Weltsprache sich gern und oft über sich selbst Gedanken macht. Die enger zusammengerückten Poeten vergewissern sich gemeinsam ihrer gemeinsamen Sache. Les Murray erklärt in einem Gedicht, was "Ein Gedicht kann . . .", Makoto Ooka in einem anderen, was "In einem Gedicht ist . . .", und Roberto Juarroz sagt, was "Jedes Gedicht macht . . . ". Eliso Diego weiß: "Ein Gedicht ist nicht mehr als . . .", und Enzensberger schreibt "Gedichte für die Gedichte nicht lesen". John Ashbery eröffnet ein Gedicht mit der Erklärung: "Dieses Gedicht befaßt sich mit Sprache auf einer sehr einfachen Ebene", während ein Text von Michael Palmer skeptisch bleibt: "Kein Text ergibt irgendeinen Sinn". Und so fort in einer langen Kette poetologischer Selbstbestimmungen - jede Fata Morgana ein déjà-vu.
Natürlich liegen einzelne oder kleine Gruppen hier weit abseits von dieser europäisch-amerikanisch-fernöstlichen Gegend, Gedichte arabischer und afrikanischer Dichter vor allem. Da spätestens endet auch der exotische Reiz der fremden Sprachen und weicht der ernüchternden Feststellung, wie vieles doch im Original verständlich ist. Fast schon hatte man es natürlich gefunden, daß etwa afrikanische Autoren in englischer oder französischer Sprache schreiben. Hier erst, zum Beispiel neben dem eigensinnigen Lettisch der Amanda Aizpuriete, werden diese Sprachwunden kolonialer Landnahmen wieder als Skandalon wahrnehmbar. Bezeichnenderweise sind es denn auch allein einige dieser afrikanischen Poeten, die intensiv nach volksliterarischen Wurzeln suchen: der Algerier Kateb Yacine etwa in Volkslied-Sammlungen unter den Berbern, der Ghanaer Kofi Nyidevu Awoonor in Zeremonialtexten seiner Heimat. "Wir grüßen das von der Sintflut errettete Afrika", schreibt der im französischen Exil lebende Marokkaner Abdellatif Laâbi, "ich danke dir Europa daß du mich unter dem Banner deiner rationalen und universellen Sprachen / vereint hast." Das verstörend grelle, aggressive Langgedicht "Die elektronischen Affen", das sich so präsentiert, gerät zu einem der fremdesten Texte dieser Sammlung. Hier flackert wirklich etwas auf von den unheimlichen Leuchtfeuern, die Sartorius im Vorwort beschwört. Kein Pathos der négritude mehr, nicht einmal ein emanzipatorischer Wegweiser, nur ein zerfetztes Textmonstrum, dessen Bruchkanten noch immer schneiden.
Gedichte wie dieses erregen in ihrer Maß- und Rücksichtslosigkeit tiefer als die cleverste language poetry amerikanischer Gegenwartspoeten. Aber wehe dem, den es da nach Ethno-Romantik verlangt, und selig die Literaturen, deren Umstände solche Texte nicht mehr fordern, die Muße haben und frei sind für das zierliche Pingpong zwischen Haikus und Terzinen.
Bei aller Vertrautheit aber wäre hier doch nichts abwegiger als eine Wiederholung der schon mehrfach ausgedienten Rede vom Ende der modernen Poesie. Woher denn? Das Gedicht hat sich keineswegs erledigt, es lebt und gedeiht. Aber es scheint so, als habe es seine Mittel und Möglichkeiten ziemlich vollständig entfaltet. So wie hier Sonette in allen möglichen Varianten zu lesen sind, einmal sogar Stanzen (versteht sich: immer als zitierte und gebrochene Formen), so erscheinen auch die reimlosen und freien Verse, die meditativen Tanka-Strophen und die erzählenden Gedichte, die "lyrischen" und die prosaischen, die agitierenden und die kontemplativen Texte, die konstruktiven "Systemdichtungen" und die aleatorisch-assoziativen Sprachspiele allesamt als heterogene und doch schön gefügte Teile eines großen, angenehm bunten Fächers; neben-, aber keineswegs gegeneinander, formenreich und spannungsarm, Exempla eines modernistischen Klassizismus wider Willen.
Und selbst wenn man die neuen Avantgardisten hinzunähme, auf die Sartorius weitgehend verzichtet, also etwa Thomas Kling statt Durs Grünbein, der Befund würde sich nicht ändern: die da gespielten Instrumente sind selbst schon ein paar Generationen alt und klingen darum, gut gestimmt wie bei Kling, so altmeisterlich schrill wie eine dadaistische Stradivari.
Als neuartige Tendenzen erwägt der Herausgeber das Festhalten vieler Dichter an einer appellativ-politischen Wirkungsabsicht des Gedichts, das Beharren anderer auf seinem "metaphysischen Charakter", schließlich das Vergnügen einer dritten Gruppe am poetischen Sprachspiel. Ja, so ist es wohl. Aber so ist es auch in poetologischen Texten seit dem späten neunzehnten Jahrhundert immer wieder zu lesen. Wenige Texte dieser Sammlung entkommen den Mustern und Modellen, die eine seither entwickelte und immer verfeinerte Moderne ihnen bereitstellt. Aber warum sollten sie auch?
Vermutlich sollen sie bloß, weil lyrische Dichtung, spätestens seit sie sich selbst als "modern" bestimmt, die permanente Innovation verinnerlicht hat wie einen Walzerrhythmus; ihre einzig verbindliche und verläßliche Tradition war immer der Traditionsbruch. "Etre absolument moderne", das hieß vor allem: nichts nochmal tun. Die Entautomatisierung unseres Sprechens und Denkens, die Wiedereröffnung unserer Sinne, die sich das "Projekt" (J. Habermas) einer ästhetischen Moderne vor rund einem Jahrhundert vorgesetzt hatte, könnte selbst automatisch geworden sein. Der einfachste und menschenfreundlichste Gedanke einer undramatischen Postmoderne wäre vielleicht: den kategorischen Innovationsimperativ aufzugeben. Die immerwährende Revolution der Künste, in weiten literarischen Landstrichen schon abgeblasen, dauert in einigen unbeugsamen Dörfern noch an. Eines dieser Dörfer sind der Titel und die Einleitung dieser Sammlung. Auch wenn uns viele dieser Texte ganz neu sind, ihre Poesie ist es nicht. Schön so.
Natürlich gibt es auch diesseits von Afrika poetische Sprachen, die ungehört und unerhört sind. Einen engagierten Hermetismus etwa, der die poetische Gegen-Rede im Angesicht der Bildschirme abermals steigert, der babylonische Elfenbeintürme von beträchtlicher Höhe errichtet. Oder die unkalkulierbaren Wunder der Unschuld, die jederzeit plötzlich geschehen können und uns hier zum Beispiel in der "Widmung" der Olga Sedakowa zuteil werden.
Und dann gibt es natürlich jene mächtige Strömung, die sich in die hier kartographierten Landschaften längst schon eingeschnitten hat, sie wässert und sich auch aus ihren Bächen speist, die aber in solchen Atlanten seltsamerweise noch immer nicht vorkommt. Die Rede ist, pars pro toto, von Bob Dylan. Nicht von dem, der nach landläufiger Gönnermeinung doch "eigentlich" ein Lyriker sei, im etwas peinlichen Pop-Gewand, sondern von dem erklärten "song and dance man", dem "performing artist", und der längst Weltkunst gewordenen oralen Kultur, die er resümiert und repräsentiert. Natürlich, Dylans Songs haben schon als Texte eminent poetische Qualitäten. Aber dann ist da eben auch diese Überfülle von Klängen, Phrasierungen, Songmustern unterschiedlichster anglo-amerikanischen Traditionen vom Blues bis zur Filmmusik, von Chuck Berry bis zu Sam Shepard. Und dann und vor allem ist da die Präsenz der Stimme, die Inszenierung und Zufälligkeit des Augenblicks, den die Schallplatte festhält.
Das ist Klang- und Wortkunst einer eigenen Tradition, gleich weit entfernt von poetry wie von Partituren, und mit beiden doch verschwistert. Dylans bisher letzte Alben enthalten keine neuen Songs mehr, sondern blicken aus der Ära der Videoclips zurück auf die eigene Tradition, hinter die eigenen Anfänge zurück bis ins 19. Jahrhundert: Museen einer Moderne, die bei Sartorius und Hartung sowenig vorkommt wie in Enzensbergers Grund- und Musterbuch.
Dabei tun sie, Wand an Wand und ohne voneinander viel Notiz zu nehmen, dieselbe Arbeit. Zwar überschreitet, was sich zwischen den ersten blue notes und Dylans archäologischer Rückwendung vollzogen hat, die Grenzen der Schriftkultur, deren Archen hier vor Anker liegen. Aber die Archenbauer und die Archäologen haben längst mehr gemeinsam, als sie trennt. Tatsächlich zeigt Sartorius' Sammlung am deutlichsten jenen konservativen Grundzug, der schon die chronologische Anlage in Hartungs "Luftfracht" bestimmte und den Enzensbergers "Museum" ironisch im Titel führte. Präzise gibt er sich da zu erkennen, wo der Schlußsatz des Enzensbergerschen Einleitungsessays wieder aufgegriffen wird. Der hatte 1960 gelautet: "Auch die moderne, wie jede Poesie, spricht von etwas, spricht aus, was uns betrifft." Sartorius 1995 vernimmt "diese Stimmen von außen, die . . . zum Bewahren dessen führen, was uns betrifft, das könnte die Poesie sein".
Bewahren, das ist's. Die Stimmen drohen zu verstummen; was uns betraf, verschwindet; die Welt geht häßlich zu Ende. Schön, daß es Anthologisten gibt, die ihre Archen zimmern für eine in Altersschönheit strahlende neue Poesie und ihre Urheber. Das letzte Wort habe darum Stefán Hördur Grímsson, der isländische Heringsfänger und Dichter: "Verzeiht mir ihr Götter diese wiedergekäuten Phrasen der Illustrierten. / Lobt Gott, das Gedicht und die Liebe / bis zuallerletzt."
Joachim Sartorius (Hrsg.): "Atlas der neuen Poesie". Rowohlt Verlag, Reinbek 1995. 352 S., geb., 48,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Die lehrreichste und aufregendste Lyriksammlung der letzten Jahre. Frankfurter Rundschau
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für