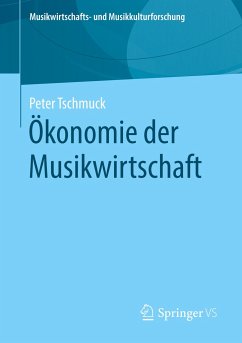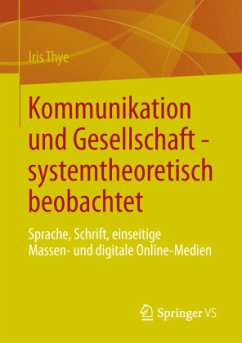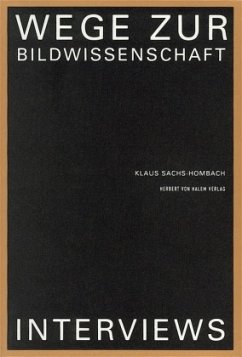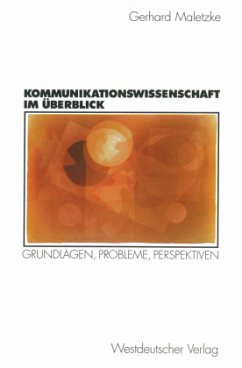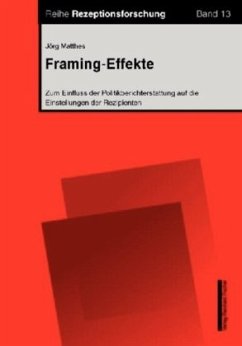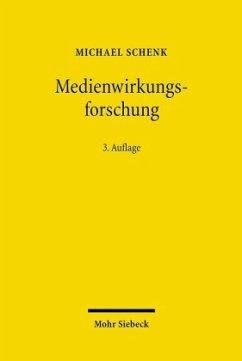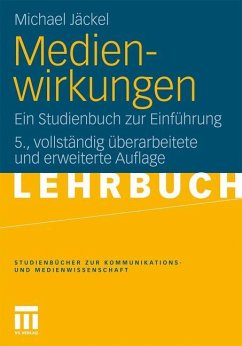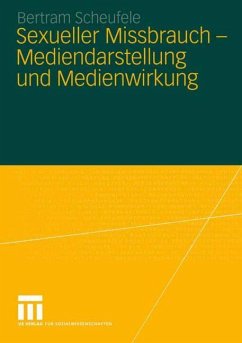halt die Selbstreferentialität der Kunst und die Rhetorizität ihrer Formensprache.
Gerade deshalb muß man Martin Andree dankbar dafür sein, daß er den vielfältigen Kurzschlüssen zwischen Kunst und Leben, welche in Literatur- und Medienwissenschaft meist nur als Schulbeispiele für krasse Fehllektüren dienen, eine systematische Untersuchung widmet. Der Germanist nähert sich dem Thema in seiner Dissertation ohne die Arroganz einer Branche, der selbstmordgefährdete "Werther"-Leser oder in den Leib Christi verschossene Nonnen allenfalls für akademische Schenkelklopfer gut sind. Und er weigert sich, die unmittelbare Ansprache auf Medien als banales Massenphänomen abzuhandeln, wie es die Medienwirkungsforschung mit ihren empirischen Erhebungen tut. Rezeption, die über reflexive Verinnerlichung hinausgeht, ist kein Tummelplatz für vormoderne Trottel und hysterisches Fernsehvolk. Vielmehr liegt hier der Kernbereich dessen, was seit der Antike an Medien fasziniert - und paradoxerweise vielleicht auch der Grund dafür, warum das bloße Leben allein noch nie ausgereicht hat.
Andrees über fünfhundert Seiten starke Dissertation, die sich mit einem etwas überstrapazierten Begriff als "Archäologie" der Medienwirkung bezeichnet, ist eher eine Universalgeschichte der "emphatischen Kommunikation" - also ein Kompendium all jener Mitteilungsformen, die ein Jenseits der Zeichen, Diskurse und Apparate anvisieren. Den entscheidenden Wegweiser durch dieses Terrain, das die Theorie seit Jahrzehnten mit Verbotsschildern umstellt, findet Andree ausgerechnet beim Ahnherrn der neueren Nichts-als-die-Schrift-Lehre. Denn in der "Grammatologie" beschreibt Jacques Derrida die Präsenz als "Selbstüberschreitung der Medialität in der Medialität".
Indem Andree diese Formel auf seinen kulturhistorischen Streifzug mitnimmt, bleibt er nur scheinbar einer Schule verhaftet, die Präsenzeffekte routiniert als Taschenspielertricks im Reich der Zeichen entlarvt. Tatsächlich verläßt er die Deckung der Großtheorie und schenkt den Zeugen medialer Offenbarungen von Pseudo-Bonaventura über Daniel Defoe bis hin zu Novalis grundsätzlich Glauben, anstatt sie im vorhinein als Konstrukteure zu überführen.
Dabei spart Andree in seiner reichillustrierten Arbeit, die Schwerpunkte in der Antike, im Mittelalter und im achtzehnten Jahrhundert setzt, keineswegs am methodischen Unterbau. Selbst ein schwammiger Begriff wie jener der Ähnlichkeit wird, anstatt bloß die üblichen Benjamin- und Foucault-Fußnoten einzubauen, neu vom Fundament hochgezogen. Wenn Passanten Tizians zum Trocknen ins Fenster gehängtem Papstbildnis die Reverenz erweisen, scheint diese Anekdote die Ähnlichkeit zwischen Urbild und Abbild zu verhandeln. Tatsächlich arbeitet Andree heraus, daß Ähnlichkeit immer einen außenstehenden Beobachter voraussetzt. Die Wirkung ist das einzige Kriterium, das für das Vorliegen einer Mimesis zur Verfügung steht.
Tatsächlich beruht die Faszination jenes Genres, das Andree mit dem Terminus "Ultrarealismus" belegt und das die allzu lebensecht gemalten Trauben des Zeuxis mit den jeweils neuesten Videospielen für die Playstation verbindet, nicht auf dem Wiedererkennen des ohnehin schon in der Außenwelt vorhandenen Gegenstands, sondern auf dem Bestaunen der Ähnlichkeit selbst. Insofern legt Andree auch eine Studie über den Realismus vor, welche die wahre Brisanz der in Oberseminaren zu Unrecht als unterkomplex abgestempelten Gegenstandsästhetik aufzeigt. Schon im antiken Griechenland wurde die Tragödie mit ihren die Emotionen aufpeitschenden Illusionen als "Hereinbrechen einer virtuellen Welt" empfunden, und 1794 schrieb Johann Gottfried Hoche über die Flut fiktionaler Texte: "Es ist mir unbegreiflich, wie sich Menschen so lange in erdichteten Welten herumtummeln. Es giebt ja wahre Geschichten und gute Reisebeschreibungen genug."
Die massenhafte Verbreitung erfundener Geschichten verdankt sich nach Andree nicht nur der steigenden Nachfrage der Buchdrucker nach Manuskripten, sondern auch der dadurch angeheizten Neugier, die im "spannenden Roman" ihren bevorzugten Gegenstand fand. So löst ein oberflächennahes Kriterium die alte Tradition des Mysteriums ab, das in der religiösen Lektüre die Versenkung in die Schrift erforderte. In jedem Fall aber sind es durchdringende Reize, welche das Leben der Rezipienten auf den Text ausrichten - und meistens setzt die kulturkritische Wendung gegen den seiner Sucht verfallenen Rezipienten nur einen neuen Schlüsselreiz in die Welt, der wiederum seine unwiderstehliche Wirkung entfaltet.
Da Andree seine Arbeit nicht chronologisch gliedert, sondern entlang verschiedener "Faszinationstypen" wie "Erlebnis" oder "Ursprung", durchquert der Leser zweitausend Jahre in immer neuen Durchgängen. Manchmal zielt Andree mit seinen kühnen Verbindungslinien, die zum Beispiel von Platon über Origines bis zum Splatterfilm reichen, von hinten durch die Brust ins Auge - mehr Konzentration in der an Querverweisen überreichen Argumentation hätte nicht geschadet. Doch meistens hält das Buch die Balance zwischen gründlicher Quellenarbeit und feuilletonistischen Exkursen, in denen zum Beispiel die Faszination von Elvis Presleys künstlichem Paradies "Graceland" ausgedeutet und auch mal Nick Cave zitiert wird. Die Stärke dieser Arbeit liegt darin, daß sie auf breiter Materialbasis mit der Fiktion eines selbstgenügsamen Kunstsystems aufräumt. Auch wenn kein Mensch jemals ernsthaft Kunst und Wirklichkeit verwechselt hat: Ohne ihre wundersamen Auswirkungen auf das Leben wären Medien nichts als tote Dinge.
ANDREAS ROSENFELDER
Martin Andree: "Archäologie der Medienwirkung". Faszinationstypen von der Antike bis heute. Wilhelm Fink Verlag, München 2005. 598 S., Abb., br., 60,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.01.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.01.2006