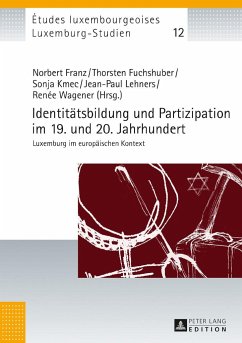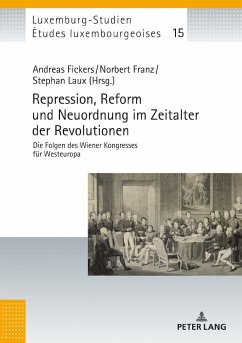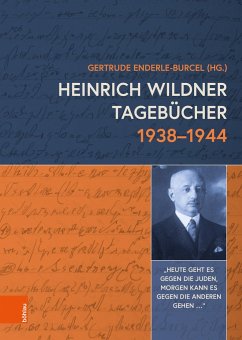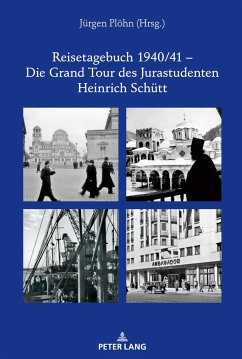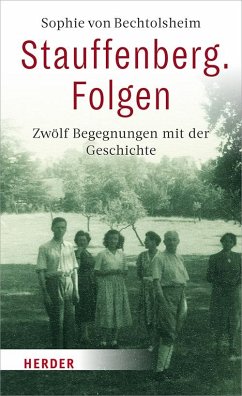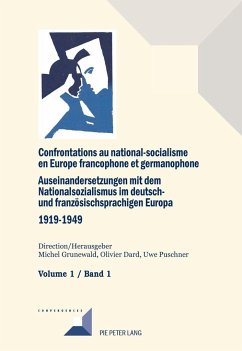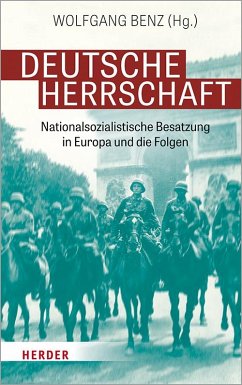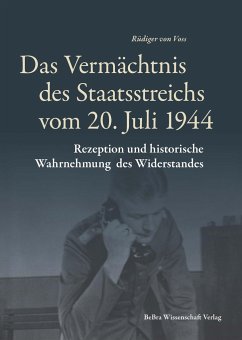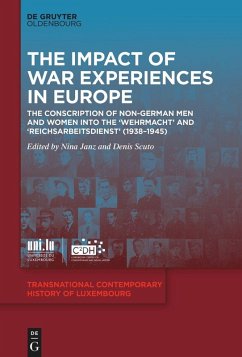waren dabei die Arbeiter der Schwerindustrie.
Das Buch von Marc Schoentgen zeigt in akribischer Recherche und klarer Sprache, welche Mittel NS-Organisationen einsetzten, um für ihre Politik zu werben. Zu Beginn wurden zwar individuelle Rechte der Arbeitnehmer ausgehebelt und Gewerkschaften verboten, aber es gab auch Kameradschaftsabende mit Zauberkunst, orchestrierte Propaganda und teilweise Lohnerhöhungen. "In Ansätzen gelang es den Nationalsozialisten, die politischen und gesellschaftlichen Strukturen zu zerstören, von einer allgemeinen Begeisterung oder einer breiten Akzeptanz konnte allerdings nie die Rede sein", berichtet Schoentgen. Nicht nur beim sozialen Wohnungsbau mussten sich die Menschen mit Versprechungen zufriedengeben. "Prestigeprojekte, wie der KdF-Volkswagen oder Kreuzfahrten mit KdF-Dampfern, blieben in weiter Entfernung von den Luxemburger Volksgenossen. Das Vertrösten auf die Zeit nach dem Krieg reichte kaum aus, die Glaubwürdigkeit des Regimes zu erhöhen."
Die Nazis verursachten zu viele Veränderungen in kurzer Zeit, und dies mit zu wenig Verständnis für luxemburgische Besonderheiten. Zudem wurden in der Regel weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber konsultiert, sondern vor vollendete Tatsachen gestellt. "Dies erhärtete den Eindruck, dass alles Wichtige von anonymen Behörden oder fernen Parteidienststellen in Koblenz entschieden wurde, während man auf die Befindlichkeiten der früheren Sozialpartner keinerlei Rücksicht nehmen wollte", schreibt Schoentgen. Die Überzeugungsarbeit war falsch durchgeführt, auch wenn sich Gauleiter Gustav Simon gelegentlich für "seine" Genossen in Luxemburg einsetzte und verhinderte, dass zu viele Arbeitskräfte in kriegswichtige Betriebe an Rhein und Ruhr abgezogen wurden.
Einschneidend, und bis heute tief im luxemburgischen Gedächtnis verhaftet, war der Streik im September 1942. Anlass waren die Erhöhung der Arbeitszeiten und die Einführung der Wehrpflicht. Zwar dauerte der Streik nur einige Stunden, und es gab "kaum Auswirkungen auf die Produktion in der Schwerindustrie oder in den Erzgruben", berichtet Schoentgen. Die deutschen Behörden wurden von den Ereignissen jedoch völlig überrascht. Dies zeigt, wie wenig die Nationalsozialisten wirklich über Luxemburg wussten und wie wenig sie sich um den Alltag der Arbeiter kümmerten. Diese waren nämlich verärgert, dass Züge und Straßenbahnen ihre Fahrpläne nicht an die geänderten Arbeitszeiten angepasst hatten, sodass man nicht rechtzeitig zum Betrieb oder nach Hause fahren konnte. Viele malochten daher weiterhin nur acht Stunden. Direktoren und Betriebsobmänner versuchten die Lage zu beruhigen, gingen von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz. Als gutes Zureden nichts nutzte, machten sie die Arbeiter darauf aufmerksam, dass ihre Handlungen "zu Folgen führen, die sich recht unangenehm auswirken können".
Mehr als zwanzig Streikende wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet. Damit verloren die Behörden letzte Sympathien. Ende 1943 erkannte auch die Zivilverwaltung, dass sich die Luxemburger nicht mehr einlullen ließen, und setzte die Daumenschrauben an. Mit Strafen sollte massenhaftes Blaumachen unterbunden werden. Zwar blieben die Fördermengen des Eisenerzbergbaus jahrelang auf hohem Niveau, allerdings sank die Qualität. Die Arbeiter wurden nach Mindestfördermengen bezahlt und hatten "wohl wenig Lust, sich für die deutsche Kriegsproduktion ins Zeug zu legen". Bis zum Ende der Besatzung 1944 bekamen die Verantwortlichen das Problem nicht in den Griff.
Die Bilanz der nationalsozialistischen Politik im Bereich der Sozialversicherungen bezeichnet Schoentgen als zwiespältig. Für bestimmte Berufsgruppen gab es Verbesserungen. Zugleich wurden mit der Auflösung der luxemburgischen Krankenkassen und Rentenkassen die Rechte der Versicherten stark eingeschränkt. Abgeschafft wurden das luxemburgische Arbeitsrecht und die freie Arbeitsplatzwahl. Unmittelbar nach der Befreiung wurde all das rückgängig gemacht, Berufskammern und Gewerkschaften nahmen ihre Arbeit wieder auf. Deren Ersparnisse indes waren verloren. Zeitgleich begann die Verfolgung der Mitläufer. In den meisten Unternehmen hatte sich das Problem erledigt, da Kollaborateure das Land in letzter Minute mit den Deutschen verlassen hatten. Alles in allem empfanden die luxemburgischen Arbeiter das braune Zuckerbrot als zu bitter. Offener Widerstand oder aktive Sabotage blieben aber eine Ausnahme. Viel bitterer war es indes für die Zwangsarbeiter, die nach und nach ins Land kamen und die den Luxemburgern vor Augen führten, dass der Nationalsozialismus noch schrecklichere Folgen mit sich bringen konnte. Die Kollegen aus Osteuropa spürten nur die Peitsche. JOCHEN ZENTHÖFER
Marc Schoentgen: Arbeiten unter Hitler,
NS-Sozialpolitik, Deutsche Arbeitsfront und Herrschaftspraxis im besetzten Luxemburg am Beispiel der Schwerindustrie 1940-1944, Peter Lang, Berlin 2021, 688 Seiten. 50 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
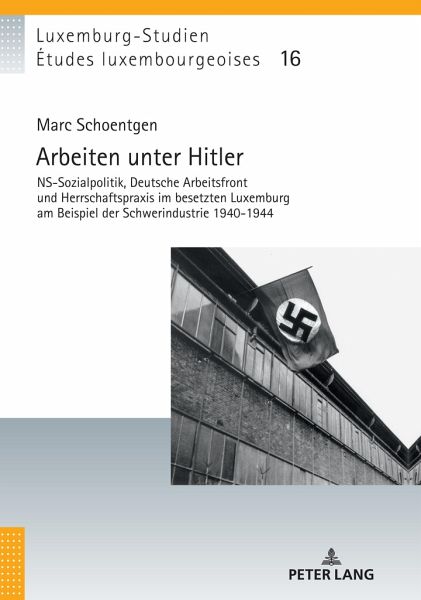




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.02.2022
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.02.2022