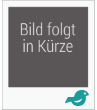Nicht lieferbar

Ararat
Pilgerreise eines Ungläubigen
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Der Ararat, mit über 5000 Metern höchster Berg in der Türkei, ist Ort eines in vielen Religionen verbreiteten Glaubens: Hier setzte nach dem Ende der gottgewollten Sintflut die Arche Noah auf. Auch Frank Westerman, Autor mehrerer preisgekrönter Bücher, hat dieser Mythos seit seiner Kindheit nicht mehr losgelassen. Ihn interessiert vor allem die Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Schöpfungsglaube. Welche Motive treiben eine wachsende Zahl von Arche-Suchern auf die Gletscherkappe des Ararat? Warum setzt ein Astronaut nach seiner Rückkehr aus dem All alles daran, dort einen Gottesbewe...
Der Ararat, mit über 5000 Metern höchster Berg in der Türkei, ist Ort eines in vielen Religionen verbreiteten Glaubens: Hier setzte nach dem Ende der gottgewollten Sintflut die Arche Noah auf. Auch Frank Westerman, Autor mehrerer preisgekrönter Bücher, hat dieser Mythos seit seiner Kindheit nicht mehr losgelassen. Ihn interessiert vor allem die Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Schöpfungsglaube. Welche Motive treiben eine wachsende Zahl von Arche-Suchern auf die Gletscherkappe des Ararat? Warum setzt ein Astronaut nach seiner Rückkehr aus dem All alles daran, dort einen Gottesbeweis zu finden? Die Erkundungen und Beobachtungen Westermans verwandeln den Mythos überraschend zu einer perfekten Projektionsfläche für existenzielle gegenwärtige Themen vom Klimawandel bis zum religiösen Fanatismus. Westermans Report seiner Reise zum Ararat ist nicht nur der spannende Bericht einer Selbsterforschung. Seine Recherchen an den Rändern zweier Kontinente, zweier Religionen und zweier politischer Systeme vermitteln zugleich Einblicke in die historischen und heutigen Konflikte zwischen Türken, Kurden und Armeniern und zeichnen ein sensibles Bild dieser umkämpften Region.