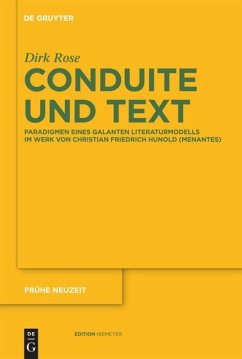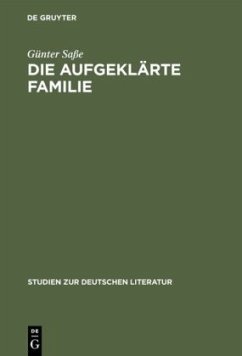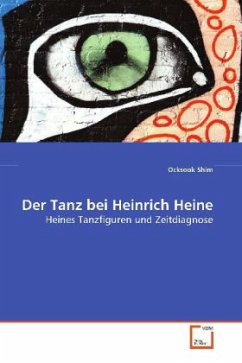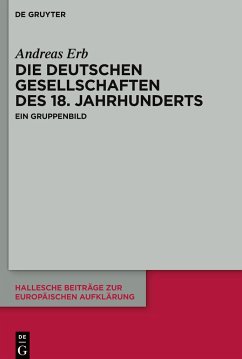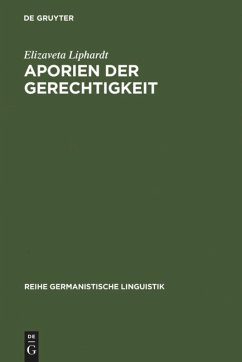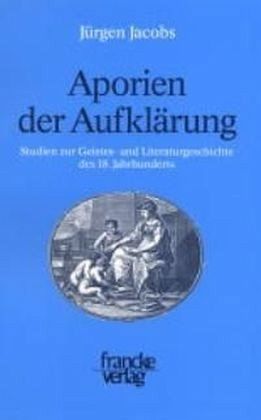
Aporien der Aufklärung
Studien zur Geistes- und Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
24,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Die Aufklärung des 18. Jhs. ist keine monolithische Erscheinung, vielmehr treten in ihr höchst heterogene Impulse zutage. So führte das aufklärerische Räsonnement einerseits zur Begründung einer Vernunftmoral mit universellem Geltungsanspruch, andererseits aber verwies man auf die empirische Vielfalt der moralischen Vorstellungen und gelangte zu einer relativistischen Position. Auch der Glaube an einen Fortschritt der Menschheit erweist sich als gebrochen durch einen Zweifel an der Lebensform zivilisierter Gesellschaften, wie er sich etwa im Mythos des "edlen Wilden" meldet. Die Untersuc...
Die Aufklärung des 18. Jhs. ist keine monolithische Erscheinung, vielmehr treten in ihr höchst heterogene Impulse zutage. So führte das aufklärerische Räsonnement einerseits zur Begründung einer Vernunftmoral mit universellem Geltungsanspruch, andererseits aber verwies man auf die empirische Vielfalt der moralischen Vorstellungen und gelangte zu einer relativistischen Position. Auch der Glaube an einen Fortschritt der Menschheit erweist sich als gebrochen durch einen Zweifel an der Lebensform zivilisierter Gesellschaften, wie er sich etwa im Mythos des "edlen Wilden" meldet. Die Untersuchung von Jürgen Jacobs geht solchen Widersprüchen und Aporien auf verschiedenen Feldern, z.B. der Dichtungstheorie und der Religionskritik, nach und trägt damit zu einem differenzierten Verständnis der aufklärerischen Epoche bei. Seine Aufmerksamkeit richtet sich vor allem auf Autoren wie Bayle, Wolff, Mandeville, Voltaire, Diderot, Lessing und Wieland.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.