nach. Es gehe um die Wahrnehmung der Juden als schwarz. Daß Schwarzen und Juden identische Züge zugeschrieben wurden, war Teil des kulturellen Vokabulars. Und wenn im "Parsifal" Bilder der Kastration bemerkenswert in den Vordergrund treten, lasse sich das ohne weiteres mit dem ikonographischen Sonderstatus des verweichlichten und verweiblichten Juden vergleichen. Selbstverstümmelung wurde seit dem Mittelalter mit den Juden in Verbindung gebracht; die sich nicht schließende Wunde nehme offenbar Bezug auf die ikonische Tradition des menstruierenden männlichen Juden.
Marc A. Weiner stützt sich auf die Studien von Sander Gilman. In Aussehen, Stimme, Geruch, Sexualität werde der Körper des Juden abgrenzend als das andere des Eigenen kodiert. Wagner schöpfte in der Konstruktion seiner bösen Gestalten aus dem Thesaurus dieser Codierungen. Um das zu belegen, wird die Darstellung - durchaus auch die musikalische - der Figuren von Beckmesser, Alberich, Mime, Loge, Melot, Hagen, Kundry, Klingsor materialreich in antisemitische Assoziationsfelder hineingestellt.
Daß Knoblauch nicht nach Schwefel riecht und ein Höhlenbewohner nicht auf die Dauer zum Schwarzen wird, wäre demgegenüber kein rechter Einwand. Im Zwischenreich der kollektiven Bilder geht es kaum logisch zu, hat alles mit allem zu tun. Unbefriedigend ist vielmehr, daß Weiner sich so wenig Gedanken macht, was damit nun eigentlich gesagt ist. Seine ganze theoretische Energie verwendet er auf die Absicherungsstrategien. Es sei gleichgültig, ob Wagner das auch gemeint habe. Viele andere Traditionen gingen in die Gestalten ein. Die Opern könnten trotzdem Genuß bereiten. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch so aufregt.
In Wahrheit handelt es sich um ganz konventionellen Enthüllungs-Antisemitismus. Von der "bemerkenswerten Einheitlichkeit und Schlüssigkeit in Wagners Assoziationsmustern" ist die Rede. Davon, daß "Wagner seine Repräsentanten des Bösen aus einem weitverbreiteten Repertoire antisemitischer Stereotype zusammenfügte", daß die Körperbilder "seinen metaphorischen Darstellungen des Juden als Gegenbild zum Deutschen bei seinen Zeitgenossen Glaubwürdigkeit verliehen" und daß die Juden "Verkörperung", "zentraler Bestandteil" von Wagners "ideologischem Programm" waren.
Wenn Weiner zeigte, daß Wagners Figuren teilhaben an der allgemeinen Verdichtung eines Netzes antisemitischer Stereotype, wäre die Sache ganz in Ordnung. In dem Augenblick, in dem es um ein Programm geht, stellt sich die Frage, warum der ja durchaus gesprächige Wagner keinerlei Hinweis auf eine antisemitische Auslegung gegeben hat, warum er im Gegenteil etwa insistierte, daß Mime nicht zur Karikatur werden dürfe, warum er Cosima gegenüber bekannte, einst völlige Sympathie mit Alberich gehabt zu haben. Die antisemitischen Stereotype sind Material. Es kann ein besonderes Interesse geben, gerade diese Materialschicht aufzudecken. Doch wer meint, Beckmessers Gesangsstil diene dazu, die judaisierte Kultur als oberflächlich hinzustellen, verhält sich methodisch nicht intelligenter als eine Germanistik, die Goethes Frauengestalten dingfest machen wollte. Abgesehen davon, daß Wagner gegen Koloraturen wohl kaum nur deshalb etwas hatte, weil sie ihn an die Melismen der jüdischen religiösen Gesänge erinnerten.
Und selbst gesetzt, Alberich wäre Jude, müßte noch seine Stellung im Gefüge des "Rings" interpretiert werden und was es für den Antisemitismus bedeutet, daß alles Positive scheitert. Doch wieso interpretieren? Weiner betont zwar seinen Genuß an Wagners "unglaublich schönen" Werken, aber wenn man "die für den Gesamtentwurf so zentrale Komponente des Antisemitismus" nicht erkenne, sei der "Ring" doch einfach nur eine mythische Parabel vom Kampf um Gut und Böse, Habgier und Liebe.
GUSTAV FALKE
Marc A. Weiner: "Antisemitische Fantasien". Die Musikdramen Richard Wagners. Aus dem Amerikanischen von Henning Thies. Henschel Verlag, Berlin 2000. 478 S., 26 Abb., 33 Notenbeisp., geb., 68,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main




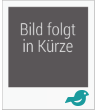

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.11.2000
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.11.2000