Menschen, ihre Erfahrungen einander anzuvertrauen. Ohne Mitteilbarkeit von Erfahrung gibt es keine Veränderung. Aber die Veränderung kann nicht der Erzähler bewirken. Er kann aufrütteln, wachrütteln, was im Lesenden ruht."
Auch in "Anprobieren eines Vaters" erzählt Hackl wieder im guten Glauben an die aufrüttelnde Kraft der Literatur von Menschen, die unter die Räder der Geschichte kamen: von unbekannten Helden der Arbeiterbewegung wie seinem Namensvetter Ferdinand Hackl oder Ikonen des Widerstands wie Che Guevara und Roque Dalton, von jüdischen Emigranten wie der Schriftstellerin Stella Rotenberg, die im englischen Exil fast zerbrach, und spanischen Anarchisten wie jenem Francesco Comella, der nach Mauthausen verschleppt wurde und sich nach 1945 dennoch zum österreichischen Franz naturalisieren ließ, von uruguayischen Tupamaros, indigenen Lyrikern und den Verschwundenen südamerikanischer Militärdiktaturen. Sie alle haben gekämpft und gelitten, wurden totgeschwiegen oder totgeschlagen, entwurzelt oder vergessen. Aber keiner hat seine Überzeugungen preisgegeben.
Solche Geschichten klingen heute leicht sentimental und unzeitgemäß pathetisch; und wer sie mit dem Vorwärts-und-nicht-vergessen-Gestus des unbeirrbaren Weltverbesserers dem "Erinnerungsnebel" entreißen will, gerät leicht unter Kitschverdacht. Hackl tappt selten in diese Falle. Einmal, weil er sich mehr für die konkreten Schicksale als für die abstrakt-allgemeinen Ideen dahinter interessiert; zum andern, weil er nie als überlegener Besserwisser auftritt, der sich gnädig zu seinen Geschöpfen herabläßt oder sie barmherzig zu sich emporhebt. Als demokratischer Erzähler will Hackl sich immer auf gleicher Augenhöhe mit ihnen bewegen, ihnen ihr Recht auf ein persönliches Schicksal zurückgeben, indem er sie mit ihren Hoffnungen und Enttäuschungen, ihrem Glauben und ihrer stillen Resignation selbst zu Wort kommen läßt.
Das Urvertrauen in die Mitteilbarkeit von Erfahrung mag der Literatur im 20. Jahrhundert weitgehend abhanden gekommen sein; Hackl nicht. Bei ihm geht die "Archäologie des Widerstands" Hand in Hand mit einer humanistischen Utopie des Erzählens, gutgläubige Dokumentarliteratur mit aufgeklärter Erinnerungspolitik. Es geht ihm um die Menschen, "denen nie gedankt und deren nie gedacht" wurde; und manchmal, etwa in der bisher unveröffentlichten Erzählung "Geschichte eines Versprechens", ist das Gedenken sogar ein Akt nachgetragener Liebe.
Natürlich idealisiert Hackl seine Figuren. Nicht, weil er ein weltfremder Träumer ist, sondern weil sie Idealisten waren, deren Mut und Stolz er selbst im Scheitern noch für bewunderns- und rühmenswert hält. Hackl ist kein autoritärer, allwissender Erzähler, aber er hat von Kain auch gelernt, daß man sich nicht dümmer stellen darf, als man ist. Mehr Suchender als Erfinder, mehr Faktensammler als Geschichtenerzähler, tritt er als Schriftsteller bis zur Selbstaufgabe hinter seine Helden des Widerstands zurück und bleibt doch mit seinen Sympathien, seiner Scham und Empörung immer gegenwärtig als Mensch. Dieses Wechselspiel von Distanz und Nähe, politisch-moralischem Engagement und lakonisch-nüchterner Beschreibung hat ihn zu einem Außenseiter des Literaturbetriebs gemacht. Hackls Form des Widerstands ist der Verzicht auf die modischen Rollen und Rituale des Erzählens, seine Zeitgenossenschaft der Anachronismus vergessener Erzähltechniken und veralteter Wörter. Wie seine Figuren im Leben, will er wenigstens schreibend die Anpassung an die herrschende Ordnung verweigern.
Diese Haltung ist nicht frei von Risiken. Indem Hackl jeder Figur ihre eigene Schreib- und Denkweise beläßt, verlieren seine Geschichten an Unverwechselbarkeit, sprachlicher Leuchtkraft und manchmal auch die Freiheit der Distanz. Nicht daß er die Widersprüche seiner Helden unterschlägt; aber er macht als Gesinnungsgenosse seine kritische Reflexion abhängig von ihrer Fähigkeit zur Selbstreflexion. Glücklicherweise sind die meisten der hier Porträtierten selbst Schriftsteller, die sich durch Sprachgefühl und ein waches politisches Bewußtsein auszeichnen, und glücklicherweise wird Hackl seinem Programm manchmal selbst untreu. Schlichtes Protokoll, Reportage, Kurzroman oder Essay, die Ordnung der Enzyklopädie, der Chronologie oder des Alphabets: Hackl probiert für jedes Schicksal eine andere Erzählform an und aus und adelt so die Pflicht des Erinnerns zuletzt doch zur literarischen Kür.
Erich Hackl: "Anprobieren eines Vaters". Geschichten und Erwägungen. Diogenes Verlag, Zürich 2004. 304 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main




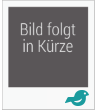

 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.07.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.07.2004