Ehrlichkeit.
Im Reigen dieser glaubwürdigen Angeber darf der Pfau nicht fehlen: Wenn Pfauenmännchen ihr Rad schlagen, stellen sie sich den kritischen Blicken des anderen Geschlechts. Es kommt darauf an, möglichst viele bunt schillernde Augenflecke vorzuweisen. Man braucht nur ein paar dieser Federn zu stutzen, schon sinkt der einstige Favorit in der Gunst seiner Artgenossinnen. Und die Pfauenweibchen tun gut daran, auf solche Äußerlichkeiten zu achten: Das prachtvolle Gefieder läßt auf innere Werte schließen. Wenn kein wißbegieriger Biologe mit der Schere eingreift, spiegelt es die körperliche Verfassung recht genau wider.
Um sich ein exquisites Federkleid leisten zu können, muß ein Pfauenmännchen gut genährt, gesund und stark sein. Denn im täglichen Leben - ob bei der Futtersuche oder bei der Flucht vor Feinden - ist solcher Zierat hinderlich. Wenn ein Vogel dieses Handicap meistert, deutet das auf vorteilhafte Erbanlagen hin, die er an seinen Nachwuchs weitergeben kann. Tatsächlich haben die Sprößlinge der prächtigsten Pfauenmännchen im Durchschnitt bessere Überlebenschancen als die Nachkommen weniger ansehnlicher Artgenossen.
Doch nicht nur bei der Partnerwahl offenbart eine plakative Show verborgene Qualitäten. Was der israelische Zoologe Amotz Zahavi als "Handicap-Prinzip" bezeichnet hat, läßt sich mitunter auch bei Begegnungen zwischen Räuber und Beute beobachten. Wenn Gazellen einen Wolf erspähen, reagieren sie oft scheinbar widersinnig. Statt schleunigst das Weite zu suchen, hüpfen sie bloß steifbeinig in die Höhe. Solche Prellsprünge zeigen dem Raubtier zum einen, daß es entdeckt ist. Zum anderen verraten sie, über welche Kraftreserven das Beutetier verfügt. Wer dabei eine gute Figur macht, kann sich nicht selten eine kräftezehrende Flucht ersparen. Meist verzichten die Wölfe auf eine Hetzjagd, wenn sie ihre Erfolgschancen als allzu gering einschätzen. Auf die Angaben der Gazellen können sie sich verlassen, denn eine exzellente Kondition läßt sich nicht einfach vortäuschen. Dasselbe gilt übrigens auch für Lerchen, die lauthals singen, während sie vor einem angreifenden Falken davonfliegen. Indem sie glaubhaft machen, daß ihnen der Atem so bald nicht ausgehen wird, entmutigen sie ihren Verfolger. Erfahrene Falken brechen ihre Jagd dann gewöhnlich ab und suchen sich ein müderes Opfer.
Im Grunde geht es den Autoren aber nicht um Vögel und Vierbeiner. In der Forschungsgruppe Philosophie der Biowissenschaften an der Universität Gießen widmen sich Matthias Uhl und Eckart Voland vornehmlich der eigenen Spezies. Dem Handicap-Prinzip auf der Spur, betrachten sie ganz unterschiedliche Milieus. Gemeinschaften, die ihren Lebensunterhalt als Jäger und Sammler bestreiten, sind ebenso darunter wie Königshöfe der Barockzeit. Und allenthalben werden die Autoren fündig: Was man zu bieten hat, läßt sich mit freigebig verteilter Jagdbeute demonstrieren, mit kunstvoll gefertigtem Kopfputz, mit einer kostspielig ausstaffierten Dienerschar oder mit himmelwärts strebenden Monumentalbauten.
Daß Reichtum gern durch Verschwendung sichtbar gemacht wird, ist keine neue Erkenntnis. Schon vor mehr als einem Jahrhundert hat sich der amerikanische Sozialforscher Thorstein Veblen mit diesem Phänomen beschäftigt. In seiner "Theorie der feinen Leute" analysierte er, wie sich die Hautevolee unmißverständlich vom gemeinen Volk abhebt: durch demonstrativen Müßiggang und demonstrativen Konsum, also gezielte Verschwendung von Zeit und Geld. Als Veblen den Lebensstil der Oberschicht unter die Lupe nahm, dachte er freilich noch nicht an Evolutionsbiologie. Diesen Aspekt in den Mittelpunkt zu stellen bleibt den Gießener Wissenschaftlern vorbehalten. Ihrer Ansicht nach ist der Drang, sich vorteilhaft in Szene zu setzen, tief in unserem Erbgut verankert: Ebenso wie im Tierreich geht es letztlich um Erfolg im biologischen Sinne, um möglichst viele Kinder, die dann möglichst viele Kindeskinder zeugen. Zumindest beim männlichen Geschlecht, so die Argumentation, verbessert ein hohes Prestige die Chancen auf zahlreiche Nachkommenschaft. Die Autoren geben allerdings zu, daß ein bewegtes Liebesleben im Zeitalter der Pille nicht mehr zwangsläufig eine Vielzahl von Sprößlingen nach sich zieht.
Wie aber manifestiert sich das biologische Vermächtnis in unserer heutigen Gesellschaft? Handicap-Signale in allen Spielarten, wohin auch immer das Forscherauge blickt: in der Punk-Szene ebenso wie in Professorenkreisen, auf der Autobahn ebenso wie in den Bankenvierteln der Metropolen. Selbst so destruktive Verhaltensmuster wie die Magersucht werden auf das Handicap-Prinzip zurückgeführt. Das liest sich unterhaltsam, ja amüsant, selbst wenn man nicht allem ohne weiteres zustimmen mag.
Folgt man den Autoren, so basiert der besondere Entwicklungsweg des Menschengeschlechts auf einem ausgeprägten Hang zur Großspurigkeit: "Der Übergang von den direkt nützlichen Merkmalen der äffischen Vorfahren zu den Angeber-Signalen der Menschen muß als die Initialzündung unserer heutigen Kultur angesehen werden. Erst der Einzug des An-Gebens ins Miteinander unserer Vorfahren läutete den Abschied vom Affentum ein." Diese eigenwillige Hypothese stützt sich auf die Prämisse, "daß im Sozialleben der Menschenaffen Handicap-Signale so gut wie unbekannt sind". Als mögliche Ausnahme erwähnen die Autoren lediglich die leuchtend rosafarbene Schwellung, die während der fruchtbaren Tage das Hinterteil der Schimpansenweibchen ziert.
Vermutlich wird diese Argumentation nicht jedermann überzeugen. Warum sollte das Handicap-Prinzip zum Beispiel nicht auch bei den Orang-Utans greifen? Obwohl sich das Leben dieser Menschenaffen im Kronenraum des Regenwalds abspielt, wiegen ausgewachsene Männchen oft an die zwei Zentner. Beim Klettern von Baum zu Baum dürfte sich das als beträchtliches Handicap erweisen. Eine imposante Statur hat jedoch den Vorteil, daß sie den männlichen Orang-Utans bei ihresgleichen Respekt verschafft und ihnen Sex-Appeal verleiht. Die nur halb so gewichtigen Weibchen schätzen solch stattliche Gesellen als Partner. Ein unscheinbarer Typ, der sich entsprechend unbeschwert durchs Geäst hangelt, ist für sie unattraktiv.
Auch bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, scheinen die Männchen das Zeug zum "Angeber" zu haben, wenngleich auf andere Weise als die Orang-Utans. Schon vor mehr als dreißig Jahren hat die Schimpansenforscherin Jane Goodall das typische Imponiergehabe anschaulich geschildert: Mit gesträubtem Fell und finsterer Miene werden da Zweige geschüttelt, riesige Äste über den Boden geschleift und schwere Steinbrocken schwungvoll durch die Gegend geschleudert. Diese temperamentvolle Show wird nicht nur durch dumpf schallende Rufe akzentuiert. Gegen den Boden oder einen Baumstamm trommelnd, können auch Hände und Füße zur akustischen Untermalung beitragen. Sich derart aufzuspielen birgt zwar das Risiko, andere Männchen herauszufordern und eine Tracht Prügel zu beziehen. Dennoch sind es nicht immer die Größten und Stärksten, die eine Spitzenposition auf der sozialen Leiter erklimmen. Ob das Imponiergehabe die Zuschauer beeindruckt, hängt nämlich von der individuellen Ausgestaltung ab. Gefragt sind nicht nur dicke Muskelpakete, sondern auch eine gewisse Intelligenz und soziale Kompetenz - wie im menschlichen Leben.
DIEMUT KLÄRNER
Matthias Uhl, Eckart Voland: "Angeber haben mehr vom Leben". Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2002. 230 S., 10 Abb., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
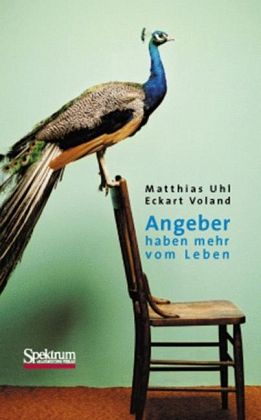




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2002