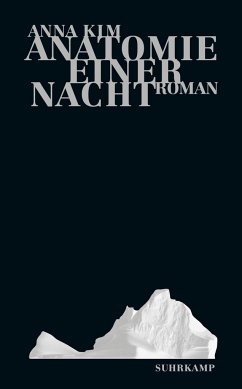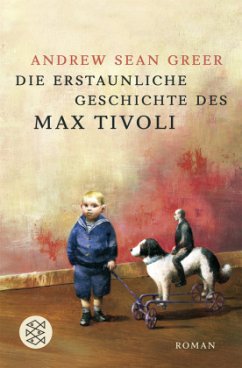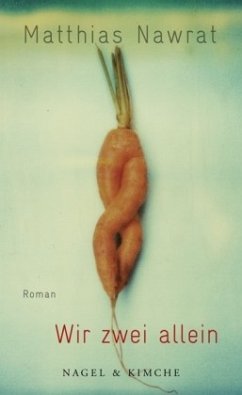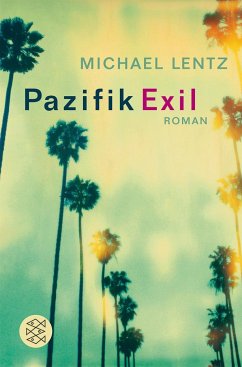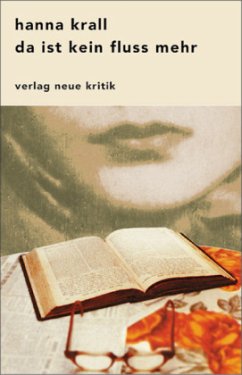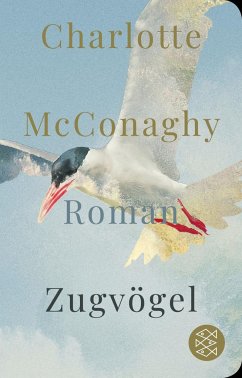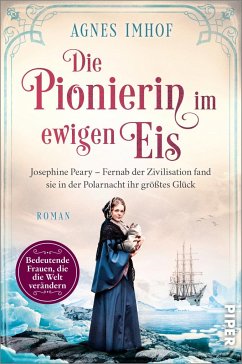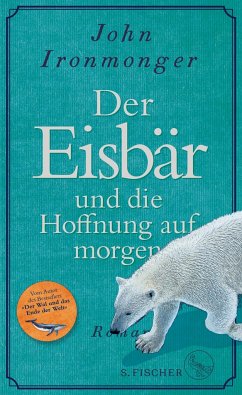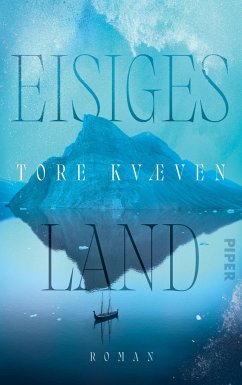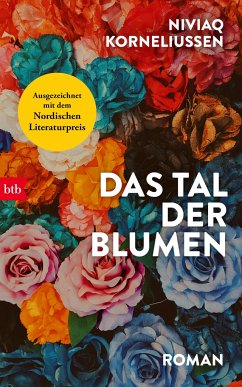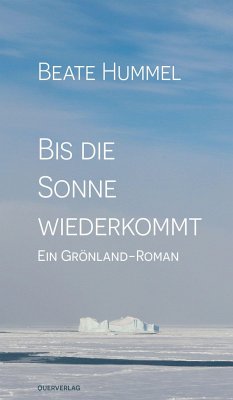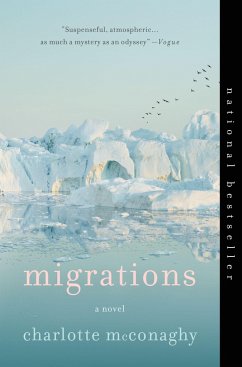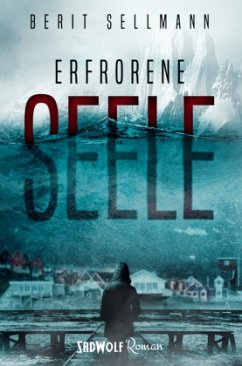Nicht lieferbar
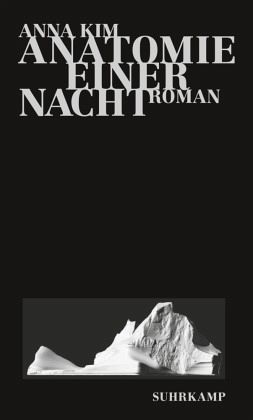
Anatomie einer Nacht
Roman
In der Nacht vom 31. August auf den 1. September 2008 nehmen sich in einer kleinen Stadt im verarmten und weitgehend isolierten Osten Grönlands elf Menschen das Leben. Wie eine Epidemie breitet sich der Freitod in allen gesellschaftlichen Schichten und Altersgruppen des Ortes aus, dessen Bewohner sich »durch eine Berührung oder einen Blick infiziert« zu haben scheinen. Oberflächlich betrachtet, stehen diese Selbstmorde in keinerlei Zusammenhang, nur einige der Toten kannten sich flüchtig. Und doch fragt sich der außenstehende Beobachter: »Ist es nicht ein Trugschluss zu glauben, das Le...
In der Nacht vom 31. August auf den 1. September 2008 nehmen sich in einer kleinen Stadt im verarmten und weitgehend isolierten Osten Grönlands elf Menschen das Leben. Wie eine Epidemie breitet sich der Freitod in allen gesellschaftlichen Schichten und Altersgruppen des Ortes aus, dessen Bewohner sich »durch eine Berührung oder einen Blick infiziert« zu haben scheinen. Oberflächlich betrachtet, stehen diese Selbstmorde in keinerlei Zusammenhang, nur einige der Toten kannten sich flüchtig. Und doch fragt sich der außenstehende Beobachter: »Ist es nicht ein Trugschluss zu glauben, das Leben eines Einzelnen habe Bedeutung nur für sich betrachtet? Genauso wenig wie der Tod eines Einzelnen Sinn macht, isoliert vom Leben der anderen.« Der Roman »Anatomie einer Nacht« von Anna Kim erzählt die letzten Stunden von elf Menschen, und er erzählt von Grönland, diesem Land der Extreme, über dem so viel Kälte und Einsamkeit und tröstlicher Zauber zugleich liegt. Behutsam und in eindringlichen Bildern folgt die Autorin den lebensgeschichtlichen Verzweigungen ihrer Figuren und gibt Antwort darauf, warum diese eine Nacht nur so ablaufen konnte, wie sie ablief.