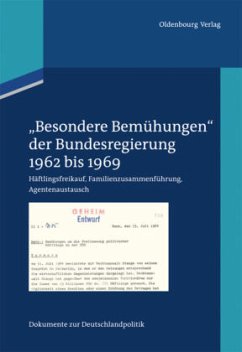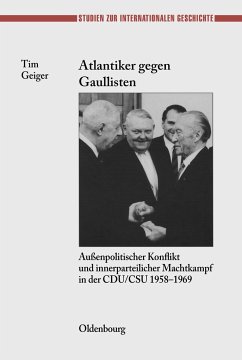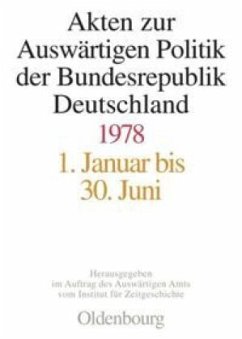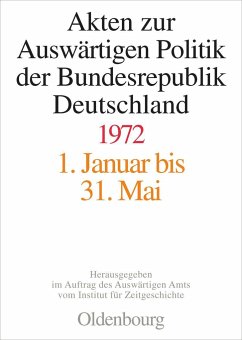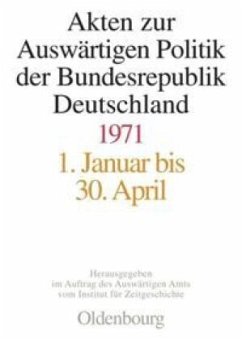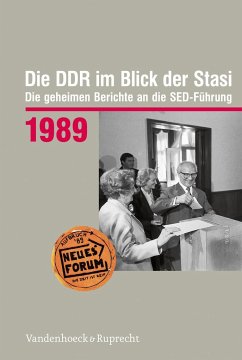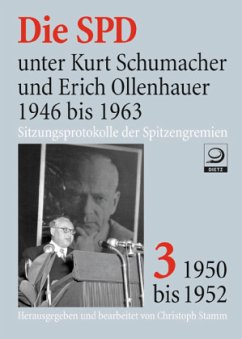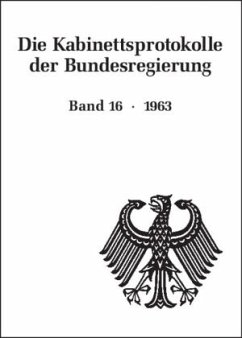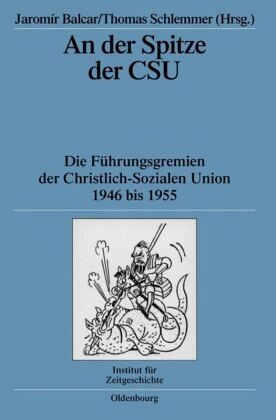
An der Spitze der CSU
Die Führungsgremien der Christlich-Sozialen Union 1946 bis 1955
Herausgegeben: Balcar, Jaromír; Schlemmer, Thomas
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
74,95 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Es ist heute fast vergessen, dass die CSU nicht immer die bayerische Staats- und Mehrheitspartei gewesen ist, als die sie in der Rückschau oft erscheint. Vor allem in den ersten Nachkriegsjahren stand die Partei auf tönernen Füßen und hatte mit erbitterten inneren Auseinandersetzungen zu kämpfen - und auch mit dem politischen Gegner. Die hier erstmals veröffentlichten Dokumente lassen einen Blick hinter die Kulissen der Parteiführung zu. Sie machen die Flügelkämpfe zwischen Josef Müller, Fritz Schäffer und Alois Hundhammer nachvollziehbar, den Aufstieg von Franz Josef Strauß, das R...
Es ist heute fast vergessen, dass die CSU nicht immer die bayerische Staats- und Mehrheitspartei gewesen ist, als die sie in der Rückschau oft erscheint. Vor allem in den ersten Nachkriegsjahren stand die Partei auf tönernen Füßen und hatte mit erbitterten inneren Auseinandersetzungen zu kämpfen - und auch mit dem politischen Gegner. Die hier erstmals veröffentlichten Dokumente lassen einen Blick hinter die Kulissen der Parteiführung zu. Sie machen die Flügelkämpfe zwischen Josef Müller, Fritz Schäffer und Alois Hundhammer nachvollziehbar, den Aufstieg von Franz Josef Strauß, das Ringen mit der Bayernpartei oder den Umgang mit Skandalen wie der Affäre um das bayerische Landesentschädigungsamt und seinen Präsidenten Philipp Auerbach. Diese Edition ist unverzichtbar für alle, die mehr über die Lehr- und Krisenjahre der CSU in Erfahrung bringen wollen.