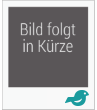Nicht lieferbar

Alles was war
Erzählung
Ein alter Mann beobachtet heimlich ein Kind. Wie der Zehnjährige morgens zur Schule geht, wie er zu Hause am Bett des kranken Vaters sitzt, der trotz schwerster Misshandlungen das KZ überlebt hat. Wie der Junge "Moby Dick" liest, am Zeitungsstand neben der "Quick" und "Revue" die Comics entdeckt, im Café Kranzler Kakao trinkt und aus dem Klassenzimmer auf die Werbung für "Creme Mouson" schaut, daneben Frankfurt am Main in Trümmern. Wie die Jahre vergehen, das Kind zum Mann wird und gegen die übermächtige Mutter aufbegehrt, während das Land sich allmählich verändert und doch stets mit...
Ein alter Mann beobachtet heimlich ein Kind. Wie der Zehnjährige morgens zur Schule geht, wie er zu Hause am Bett des kranken Vaters sitzt, der trotz schwerster Misshandlungen das KZ überlebt hat. Wie der Junge "Moby Dick" liest, am Zeitungsstand neben der "Quick" und "Revue" die Comics entdeckt, im Café Kranzler Kakao trinkt und aus dem Klassenzimmer auf die Werbung für "Creme Mouson" schaut, daneben Frankfurt am Main in Trümmern. Wie die Jahre vergehen, das Kind zum Mann wird und gegen die übermächtige Mutter aufbegehrt, während das Land sich allmählich verändert und doch stets mit seiner dunklen Vergangenheit leben wird. Wer ist der Alte, der so viel über das Leben des Jungen weiß? Michel Bergmann erzählt eine berührende Geschichte voller Magie über eine Jugend im Nachkriegsdeutschland und über das Kind in uns, das nie alt wird - und knüpft damit an seinen großen Erfolg von Die Teilacher an.