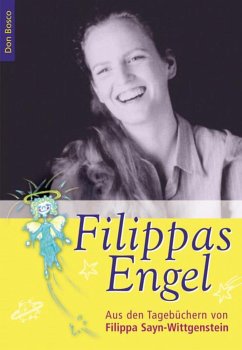Prominentenkinder brauchen ein Zuhause. Die Umstände waren jedoch prekär. 1940 im kalifornischen Exil geboren, gehörte Frido Mann von Kindheit an zu einer mit Misstrauen beäugten Sondergruppe. Eine Identität auszubilden war sehr schwer. Erst war er Tscheche, dann Amerikaner, dann Schweizer. Sein Vater, der Musiker und Germanist Michael Mann, war ein aus den Fugen geratener Sonderling, der den Sohn erst in Landschulheime und Internate steckte, dann zu den Großeltern abkommandierte und immer wieder eine bestürzende Feindseligkeit an den Tag legte.
Am meisten Elternhausersatz boten die Großeltern väterlicherseits, also Thomas und Katia Mann, zuerst in Pacific Palisades, dann in Kilchberg bei Zürich, wo Frido Mann auch später noch, während seines Musikstudiums, einige Jahre wohnte - im "Museum", wie er schreibt. Unter allen Verwandten, die er schildert - darunter der jähzornige Vater, die erschreckend kalte Mutter, die schwierigen Onkel und Tanten, die auf spartanische Kargheit geeichten Großeltern mütterlicherseits (alles in allem ein Gruselkabinett) -, geben Thomas und Katia Mann noch am meisten Liebe und Geborgenheit, auch wenn Katia verständnislos bleibt für die keimenden religiösen Neigungen des jungen Mannes und auch wenn Thomas die Größe nicht aufbrachte, mit seinem Enkelkind über "Echo" zu sprechen, das liebreizende Elfenprinzchen, für das er Frido zum Vorbild genommen hatte und das er im "Doktor Faustus" so grässlich sterben ließ. Wie entlastend wäre ein Gespräch über den Unterschied von Literatur und Leben gewesen! Die Sprachlosigkeit aber musste traumatisierend wirken, gerade in einer Familie, in der so vieles versprachlicht war. Frido fühlte sich literarisch ermordet.
Dass er unter solchen Umständen eine innere Abwehr nicht nur gegen die Werke Thomas Manns, sondern gegen Literatur überhaupt entwickelt hat, ist wenig verwunderlich. Der Liebreiz wurde zum Kainsmal. Im Abitur versäumt der Deutschlehrer die Peinlichkeit nicht, ihn nach Thomas Mann auszufragen. Wie ein Fluch verfolgt ihn, immer wenn er etwas schreibt, die Äußerung: "Das muss mindestens so gut werden wie Thomas Mann."
Frido Mann hat einen langen und respektgebietenden Weg zurückgelegt, der ihn über viele Stationen führte. Zuerst war er Musiker in Zürich, dann katholischer Theologe und wissenschaftlicher Assistent (bei Karl Rahner) in München und Münster, dann Psychologe und Psychiater in Münster und Gütersloh, dann Dozent in Leipzig, wo er sich habilitierte, dann Privatdozent und Institutsleiter für Medizinische Psychologie in Münster, dann Medizinstudent, dann Schriftsteller, deutsch-brasilianischer Kulturbotschafter und schließlich auch wieder Theologe und Weltethiker im Sinne von Hans Küng. Und es handelt sich nie um kraftlose Aufschwünge und schnelle Abbrüche; er hat alles immer mit bewundernswerter Energie zu Ende geführt, ist Doktor und Professor und hat auf jedem Gebiet nicht nur anerkennenswerte Leistungen gezeigt, sondern auch einen Idealismus an den Tag gelegt, der über das schlechte Bestehende hinaus Wege ins Unbetretene suchte. Heute sinniert er darüber nach, ob der Atheismus nicht eine nötige Kur für die oft so verkalkten christlichen Kirchen sein könnte.
Als Biograph seiner selbst widersteht er der Versuchung, seinem Lebensweg eine höhere Ordnung einzuschreiben. "Achterbahn" nennt er sein Buch. Das ist ein passender Titel, denn hier behauptet einer nicht, dass alles einen bildungsromanhaften Verlauf genommen hätte. Das Leben war eher ein Tappen von Falle zu Falle. Dem wird die Form des Buches dadurch gerecht, dass, bei chronologischer Grundanlage, immer wieder ein Blatt dazwischenliegt, das die Chronologie durchbricht. Meistens öffnen sich dann Abgründe. Da Frido Mann im Präsens erzählt, protokollartig, ist für nachträglich besserwissende Analysen des Erlebten grammatisch kein Raum. Die Erkenntnis zündet bei der Reibung der Zeitebenen.
Die Rück- und Durchblicke sind wie Klappen, die sich plötzlich nach unten öffnen zu den Verstorbenen, die keinen Frieden haben. Dann schallen die Wutausbrüche herauf, die Verstoßungen, die Verletzungen, die Grausamkeiten, die Demontagen und Verständnislosigkeiten und wollen ihn hinunterziehen. Dass Frido Mann sich aus dem Bann dieser Gespenster einigermaßen befreien konnte, ist ein Wunder, an dem, was ahnungsweise durchscheint, die Frau, mit der er sein Leben seit mehr als vier Jahrzehnten teilt, einen bedeutenden Anteil hat. Er hat sich von ihr scheiden lassen und sie kurz darauf wieder geheiratet. Er hat versucht, wegzulaufen, auch vor seiner Familie. Als aber die Wege, auf denen er dem Schicksal der Zugehörigkeit zur Mann-Familie auszuweichen gestrebt hatte, zu Ende gegangen waren, stellte er sich.
Er suchte erst den Weg zu den Verfemten des Clans, zu den Kindern und Enkeln Heinrich Manns, dann spürte er seiner brasilianischen Urgroßmutter Julia Mann nach (die wie er einst jäh ihre Heimat verlor), um endlich das große Gebirgsmassiv Thomas Mann in Angriff zu nehmen und dabei das Trauma zu überwinden. Am Schluss dieser generösen Autobiographie steht ein Bekenntnis: Als sein Sohn Stefan ihn auf die Bedeutung seines Großvaters anspricht, stellt Frido Mann gelassen fest: "Für mich war er offensichtlich ein sehr viel größerer Segen als für seine drei Söhne, möglicherweise auch mehr als für seine Töchter. Aber es sind eigentlich nur er und meine Großmutter Katia, denen ich bis heute dankbar bin."
HERMANN KURZKE
Frido Mann: "Achterbahn". Ein Lebensweg.
Rowohlt Verlag, Reinbek 2008. 383 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
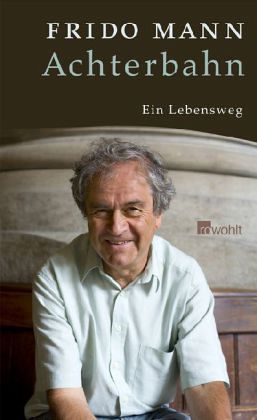





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.04.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.04.2008