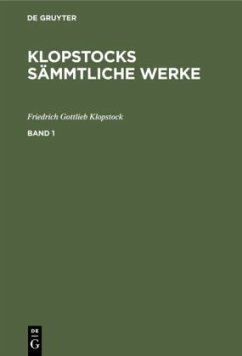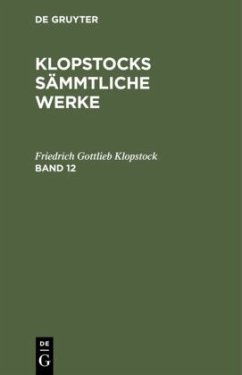unrühmlichen Rezeptionssteuerung Goethescher und Schillerscher Literaturpolitik. Heute aber hat diese ihre Wirksamkeit eingebüßt und nicht nur Klopstock, sondern auch die vom neunzehnten Jahrhundert vergötterten Weimaraner Lenker erscheinen, mit Friedrich Heinrich Jacobi zu reden, als "tote Hunde". Die mangelnde Aufmerksamkeit lässt sich nicht mehr durch den Hinweis auf irreführende Weichenstellungen innerhalb des zeitgenössischen literarischen Feldes entschuldigen.
Die aktuelle Missachtung Klopstocks, des "Dunklen", steht allerdings in keinem Verhältnis zur Bedeutung dieses Autors. Seine tiefen Spuren hat er nicht nur in der Geschichte der deutschen Literatur, sondern auch in der deutschen Sprache hinterlassen. Mehr noch als der für den Ruhm Klopstocks und seine herausstechende Selbständigkeit als Autor verantwortliche "Messias" - der dänische König warf als Dank hierfür eine Rente auf Lebenszeit aus - sind dafür die von ihm selbst anfangs nur als Beiwerke in Horazischer Nachfolge betrachteten "Oden" verantwortlich. Klopstocks Einfluss auf die syntaktische und semantische Elastizität, die die deutsche Sprache durch sie gewann, ist wahrscheinlich nur dem Luthers an die Seite zu stellen.
Die Experimente mit autonomer Metrik, die Klopstock im Kraftfeld seiner "Oden"-Dichtung unternahm, sind für Hölderlin, in einer bestimmten Phase seines Schaffens auch für Goethe ("Über allen Wipfeln") epochemachend gewesen. Mit Klopstock beginnt in Europa die literarische Moderne. Was allein die Sprache des "Deutschen Idealismus" der verschränkten Sprache der "Oden" verdankt, wäre noch eigens an den Tag zu fördern. Charakteristisch ist, dass in der Phase von 1802 bis kurz vor der Turmzeit Hölderlin einzig noch an Klopstock als Orientierungspunkt seiner eigenen experimentellen Produktion festhielt. Schiller war für ihn da schon seit geraumer Zeit in der Bedeutungslosigkeit verschwunden.
Mit der mustergültig zu nennenden philologischen Erschließung durch Horst Gronemeyer und Klaus Hurlebusch, die durch die beispielhafte Edition der "Oden" in einem Text- und zwei Apparatbänden mit zusammen fast 2500 Seiten nun vollständig vorliegt, ist der Schatz der in jeder Hinsicht revolutionären Gedichte Klopstocks jetzt vollständig gehoben. Die Ausgabe von Franz Muncker und Jaro Pawel, die von ihrem Erscheinungsjahr 1889 bis heute als maßgebliche immer wieder zitiert werden musste, ist endlich durch eine merklich umfassendere und sehr viel genauere Erschließung der Quellen ersetzt.
Umfassender ist die kritische Ausgabe Gronemeyers und Hurlebuschs dabei nicht nur in der Darstellung der Quellen, sondern vor allem in deren Sammlung. Klopstock dachte, als er anfing, Oden zu dichten, diese durchaus noch nicht im Horizont eines Drucklegungsprozesses. Eine von ihm autorisierte und konzipierte Ausgabe der "Oden" erschien erst 1771 bei Bode in Hamburg, das war fast 25 Jahre nach Beginn seiner Beschäftigung mit dieser Gattung. Zuvor gab es einzig Privatdrucke in Mikroauflage, noch häufiger aber schickte er eine, manchmal auch mehrere Oden briefbegleitend als Geschenke an Freunde und Menschen seines persönlichen Umgangs, die ihrerseits wiederum nicht selten Bewunderern des Dichters aus ihrem Freundeskreis ihre Klopstock-Autographen für Abschriften zur Verfügung stellten.
Die samisdathafte Streuung, die das Odenwerk hierdurch über halb Europa erfuhr, verlangt für eine philologische Aktion, die umgekehrt auf ihre textliche Wiederversammlung zielt, unter heutigen Bedingungen von Forschungsförderung in den Geisteswissenschaften geradezu herkulische Tugenden und - utopisches Denken jenseits lockender Antragsgratifikationen. Geduld vor allem, Ausdauer, Hartnäckigkeit und nicht zuletzt diplomatisches Geschick waren vonnöten, um die Texte Klopstocks aus ihrer Diaspora, "der Einkehr zu", in das Zuhause einer kritischen Ausgabe zu bringen. Das ist, gegen jede Wahrscheinlichkeit, nach Jahrzehnten harter Arbeit hier gelungen, und man kann das nicht genug rühmen.
Zugleich ist die Quellendarbietung gegenüber dem Stand bei Pawel und Muncker so exakt, wie es die Diskussion über die Edition neuerer Texte in den letzten Jahrzehnten als zentrales Erfordernis einer kritischen Ausgabe herausgestellt hat. "Normalisierungen" finden nicht statt, es wird mit offenen Karten gespielt. Editorische Willkür ist minimiert. Man findet jedes Komma, das in der Klopstock-Überlieferung einmal geschrieben stand, in der Ausgabe wieder. Das Konzept der Apparatgestaltung ist dabei elegant und zweckmäßig. Zu jeder Ode (nicht nur zu den von Klopstock selbst in seinen Sammlungen publizierten) gibt es einen individuellen Eintrag, gegliedert nach Überlieferung, Entstehung, Zeugnissen und Hinweisen auf die Textkonstitution. Dort, wo nur wenige Varianten auf uns gekommen sind, finden sich diese direkt im Eintrag verzeichnet; wo die Varianten - sei dies wegen der von Klopstock selbst fortwährend vorgenommenen Überarbeitungen seiner Texte oder wegen der Streuung der Überlieferungsträger - ins Kraut schießen, werden sie vergleichend, Vers für Vers, in dem zweiten Apparatband "synoptisch" dargeboten. Man kann dieser Synopse sofort ansehen, wie viel Arbeit und außerordentliche philologische Konzentration in sie eingegangen ist. Der Preis für die Orientierung am Einzelvers ist allerdings, dass man strophenübergreifende Änderungsprozesse (die Systematik einer Überarbeitung) sich selbst erschließen muss. Die Synopse wirkt durchgängig wie der textgenetische Apparat einer innerhandschriftlichen Analyse - was er definitiv nicht ist.
Das soll die herausragende Bedeutung der editorischen Leistung von Gronemeyer und Hurlebusch nicht schmälern, sowenig wie eine Reserve gegenüber einigen idiosynkratischen Dogmatismen, die Einfluss auf die beiden Bände gewonnen haben. So sind Wasserzeichenanalysen nicht darum unaufschlussreich, weil Editoren sich weigern, auf sie einzusteigen und bei Manuskriptbeschreibungen kein einziges Wort über Filigrane verlieren; und typographische Eigenheiten der so wirkungsmächtigen freimetrischen Gedichte aus dem "Nordischen Aufseher" sind nicht darum "ausdrucksirrelevante Befunde", weil ein Editor das einfach so dekretiert. Gerade in der Ernsthaftigkeit der Erschließung dieser typographischen Parameter war die Klopstock-Forschung dank der Arbeiten von Katrin Kohl schon weiter. Von diesen Bedenken abgesehen, liegt mit der abgeschlossenen Ausgabe von Klopstocks "Oden", die Gronemeyer und Hurlebusch ediert haben, ein Monument nicht nur der modernen Philologie, sondern eines geisteswissenschaftlicher Forschung überhaupt vor, das man angesichts der vielen kurzatmigen betriebsbedingten Produktionen in den sogenannten Förderrahmen gar nicht hoch genug einschätzen kann. Der Rezensent verneigt sich mit Hochachtung.
Die Typographie der Ausgabe, entwickelt von Richard von Sichowsky in den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, ist mustergültig. Der Zweckmäßigkeit von Jan Tschicholds "Sabon" als Satzschrift ist durch diese Edition ebenfalls ein Denkmal gesetzt. Der "Ladenpreis" der "Oden" allerdings ist prohibitiv. Offenbar handelt es sich um eine reine Bibliotheksauflage. Dringend zu wünschen ist, dass der Verlag bald eine erschwingliche Studienausgabe auflegt. Klopstock sollte, ohne Filter, wieder von vielen gelesen werden können als derjenige Autor, der die deutsche Literatur in die Avantgarde geführt hat.
ROLAND REUSS
Friedrich Gottlieb Klopstock: "Oden". Apparat und Kommentar.
Hrsg. von Horst Gronemeyer und Klaus Hurlebusch. Verlag Walter de Gruyter, Berlin 2015. 2 Bde., zus. 1779 S., geb., 599,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
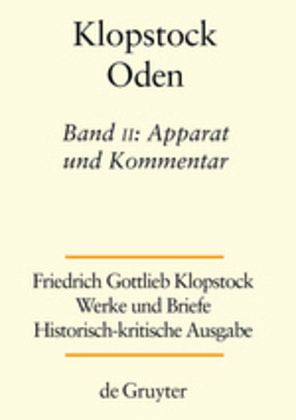




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.08.2016
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.08.2016