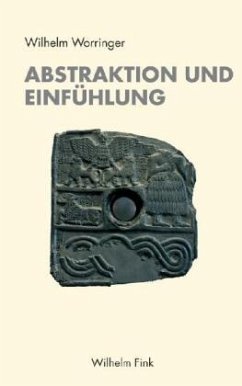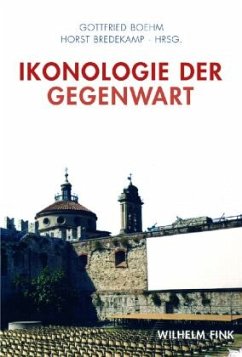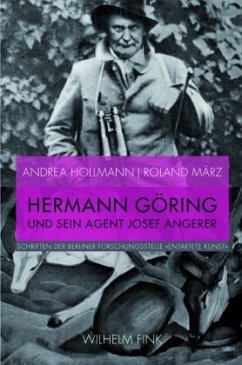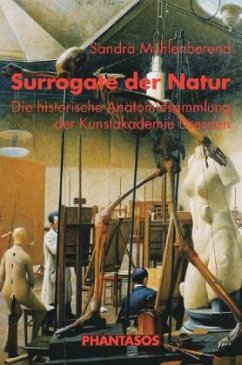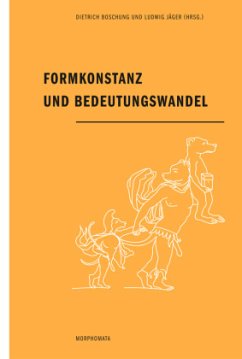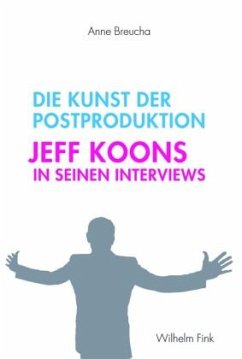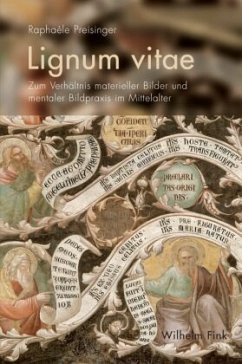Jahren gedacht und formuliert wurde.
Egenhofers Argumentation lässt sich eher in der Form eines Mosaiks verbildlichen denn als leicht abzuarbeitende Chronologie: Der Autor fügt seine kunsthistorischen Essenzen des zwanzigsten Jahrhunderts zu einem erstaunlich detailversessenen Gemisch zusammen, das so viele Jahre nach der Zersplitterung des Werkbegriffs immer noch Unruhe zu stiften vermag. Eindeutigkeiten gibt es dabei nicht, sondern man folgt einem Denkfluss, den Egenhofer am Ende seines Buchs nur unterbrechen, nicht aber abschließen kann.
Denn der Autor hätte gerne alles erklärt. Dieses Bestreben liegt in jeder Zeile. Er schreibt wie ein Maulwurf, der sich, von Theorie beladen, durch die Kunstgeschichte und Philosophie wühlt. Aber das tut er brillant, unerbittlich, eingängig: Die Geburt der von ihm ins Auge gefassten Kunst, nämlich die von Donald Judd, beginnt mit dem Aufwachen aus dem Traum der Repräsentation. Das ist das Verdienst der Moderne. Judd bricht in den sechziger Jahren den Werkbegriff auf und sprengt schließlich die Gattungsdisziplinen.
Judd hat für Egenhofer die Bewegung der Abstraktion in der modernen Malerei zum Abschluss gebracht und in seinem Werk mit dem Paradigma der industriellen Produktion gekreuzt. Er hat der Kunst beigebracht, "die Herkunft aus der Malerei zu verwinden": "Es geht um die materielle Realisierung des Werks im wirklichen Raum, um den Ausstieg aus dem Schein des ,Bildchens', um die Verabschiedung der Staffeleimalerei, aber darüber hinaus geht es um den Ausstieg aus der ,Kunst' überhaupt als der ,idealistischen' Träumerei von Leuten und für Leute, die sonst nichts zu tun haben." Mit der Entdeckung des real space habe Judd "die Grammatik des Bildes transformiert", das Bild in den dreidimensionalen Raum aufgeklappt und gleichzeitig die Kunstbetrachtung und -bestimmung mit einer neuen Problemstellung konfrontiert, die sich dem Verzicht auf Gegenstandsbezüge verdankt: Die Kunst war nun nicht mehr vom bloßen Objekt zu unterscheiden, das "Sich-Zeigen des Bildes geht in das So-Sein des Objektes" über.
Egenhofer nimmt den Leser an die Hand, wenn er Judds Eroberung des Raums mit dessen ersten Bodenarbeiten beschreibt: "Es ist gerade der Bezug zur Morphologie des Bildes, der der ersten als freistehend konzipierten komplett dreidimensionalen Arbeit Judds ihre Spannung gibt." In jeder Zeile ringt der Autor mit den terminologischen Grenzen, steckt das Territorium immer wieder neu ab und versucht, jeder Ungenauigkeit zu entgehen.
Die Lösung liegt für ihn in der Zusammenführung der Geschichte der Bildabstraktion und dem Verhältnis des modernen Werks zur kapitalistischen Warenproduktion, das in Marcel Duchamps Ready-mades zum Ausdruck kommt. In diesen beiden Polen der modernen Repräsentationskritik, dem Ready-made und dem monochromen Bild - beide vereint im Werk von Judd -, liegt für ihn die Qualität und die Kraft der Kunst der Moderne. "Der Minimalismus ist ein Schwellenmoment", schreibt Sebastian Egenhofer: "Das minimalistische Objekt zwingt dazu - und das macht die epochale Stellung der Minimal Art aus -, die Kontiguität dieser zwei Dimensionen zu denken, die im Werk der Überlieferung vom zeit-räumlichen Hiatus der Repräsentation getrennt gehalten sind." Judd hat sich nicht der gebraucht erstandenen Objets trouvés (Andre Bréton) bedient, sondern ist den neu gekauften Ready-mades gefolgt: "Der ,Kontext', aus dem das Ready-made entnommen wird, ist kein Geflecht lebensweltlicher oder umweltlicher Bezüge." An die Stelle der Idee "eine Rose ist eine Rose ist eine Rose" tritt etwas Neues: "Ein Bild ist wie eine Rose ist wie ein Stuhl, wie ein Kubus oder ein Geschmack auf der Zunge." Judds Objekte stehen für sich selbst. Jedes seiner Werke entfaltet sich auf der Basis eigenschaftsloser Existenz. Dieses Minimum ist für ihn der einzige mögliche Wert. Alles andere ist "perspektivische Täuschung".
Egenhofers Argumente enthalten Perlen der Wahrnehmung und Deutung von Kunst: So wenn er die hellgraue Farbe der Werke von Robert Morris analysiert und darüber eine Annäherung an das unmögliche Nichts versucht. Wenn er - mit Hilfe von Judds frühen Kunstkritiken - nach der Werkpräsenz und dem Weltverhältnis des Objekts fahndet oder den Eigenschaften des reinen Vorhandenseins nachspürt. Donald Judd forderte in seinen Kunstkritiken immer wieder das deutliche Qualitätsurteil. Er "glaubt nur an endliche, induktiv gewonnene Einheiten und relative, aposteriorische Ordnungen. Das betrifft die Kunst, die Politik, die Philosophie, die Wissenschaft gleichermaßen. Synthetische Urteile sind Interessensmasken." Induktiv geht auch Egenhofer vor, er scheut synthetische Urteile: Das Buch ist ein fast berauschter Rodeoritt durch die Moderne am Leitfaden der Erfahrungen des Autors vor den Objekten, verknüpft mit Theorie- und Philosophiegeschichte. Er gräbt sich ins Werk von Jackson Pollock und Piet Mondrian, von Andy Warhol und Ad Reinhardt.
Wenig ist leider von der Gegenwart zu lesen. Was sich für die Wahrnehmung zeitgenössischer Kunst ergeben könnte, wird nicht verhandelt. Dabei wäre gerade diese Übertragung auf die heutigen Verhältnisse interessant. Wird doch zurzeit gerne wieder vergessen oder mit Entdeckergestus neu präsentiert, was längst zu den Errungenschaften gehört.
Sebastian Egenhofer: "Abstraktion - Kapitalismus - Subjektivität". Die Wahrheitsfunktion des Werks in der Moderne. Wilhelm Fink Verlag, München 2008. 441 S., br., 49,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
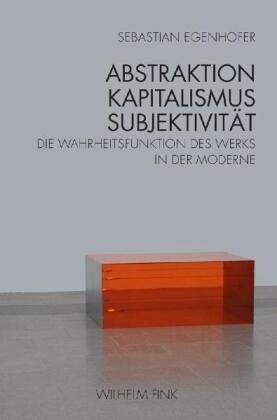




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2008