weshalb man die Chance nutzen sollte: Ein paar Morde sollten diesen Sommer schon noch drin sein. Die Auftraggeber werden sich erkenntlich zeigen.
"Abgesoffen" heißt der kurze, ausschließlich in Dialogform gehaltene Roman des 1954 geborenen Autors Carlos Eugenio López, der zu den schwärzesten, sarkastischsten und scharfsinnigsten Texten der spanischen Gegenwartsliteratur gerechnet werden kann. Der im Original bereits 2000 erschienene Roman entfaltet die Stimmen zweier Auftragsmörder, die Woche für Woche im spanischen Norden einen Maghrebiner entführen, in einer Badewanne ertränken und anschließend in die Meerenge von Gibraltar werfen, wo die Polizei die Leichen dann finden wird. Sinn der Aktion: die Migranten davor zu warnen, weiterhin nach Spanien zu drängen. Denn Spanien, so die Argumentation der Mörder, ist spanisch. Die Nordafrikaner haben ihr eigenes Land.
Die Leiche des jüngsten Opfers liegt im Kofferraum, die Männer unterhalten sich während einer dieser nächtlichen Fahrten Richtung Gibraltar. Trotzdem gelingt es López, diese Situation ins Exemplarische zu heben, den kruden Argumenten eine Logik abzulauschen, deren sich in Europa nicht nur in Rechtfertigungsnot geratene Auftragsmörder bedienen. Möglich wird das durch den Rekurs auf die Floskeln, Redewendungen und Gemeinplätze, wie sie oft anklingen, wenn sich Europäer über Flüchtlinge unterhalten.
Wo immer López, der seit langem in England lebt, die halbgaren Phrasen aufgeschnappt hat, aus denen sein Roman zusammengesetzt ist - das alles klingt eigentümlich bekannt und steht in seiner Belanglosigkeit für den Versuch, sich das gelegentlich aufkommende schlechte Gewissen vom Leib zu halten. Auch den Mördern ist nicht wohl bei ihrem Tun. Rechtfertigen, so ihre Hoffnung, lässt es sich trotzdem. Was soll man davon halten, wenn Afrikaner sterben? "Das sind Menschen", deutet der eine Killer seine Bedenken an. "Wie man's nimmt", antwortet der andere. "Sind Moros etwa keine Menschen?" - "Schon, aber nicht Menschen wie du und ich. Das ist so, als würde man sagen, Getafe ist ein Fußballclub. Das kann schon sein. Aber sind Madrid und Barcelona das deshalb auch? Nein, Madrid und Barcelona sind Madrid und Barcelona, und Getafe ist ein Haufen Hühnerkacke."
Was die vielen Themen und Anspielungen zusammenhält, ist die Trivialität des Stils, die Banalität eines aus aufgeschnappten Behauptungen zusammengesetzten Weltbilds, ergänzt durch Allgemeinplätze, welche die Killer für Lehren aus der Geschichte halten. "Schuld an unserer Misere", fasst einer der Gauner die Lage zusammen, "sind die achthundert Jahre, in denen die verdammten Moros hier waren." Das Bewusstsein, Unrecht zu tun, und der Unwille, es sich einzugestehen: López' Buch ist eine grandiose Illustration jener raffinierten Verdrängungstechniken, die Jean-Paul Sartre als "mauvaise foi" bezeichnete: Man weiß um seine Schuld, ziert sich aber, sie anzuerkennen.
Seite um Seite zeigt López, welches Reservoir dafür zur Verfügung steht, den Anschein der Selbstkritik zu wahren, sie aber tatsächlich nach Kräften zu unterlaufen. "Wenn man mitkriegen will, was in der Zeitung steht, muss man sie schon lesen", sinniert einer der Killer. Die, aus der die beiden ihr Wissen schöpfen, scheint nicht unbedingt zu den Qualitätsblättern zu gehören. Das Weltgeschehen aus der Perspektive pragmatischer Intelligenz: In wunderbar simplen Sätzen verkürzt sich die globale auf die persönliche Perspektive, erscheinen die großen politischen Dramen im Spiegel eines dekadenten Eros. Die Kubanerin und die Bosnierin stehen für billigen oder erzwungenen Sex, und von der Kapitalismuskritik führt eine schnurgerade Linie zu den Konsequenzen, die sich daraus für die Prostitution ergeben: "Eine Nutte, die sich nicht spezialisiert, kommt auf keinen grünen Zweig."
Der spanische Moralist Baltasar Gracián legte in seinem "Criticón" mit böser Lust die Heucheleien seines Zeitalters offen. Sein Landsmann Carlos Eugenio López folgt ihm dreieinhalb Jahrhunderte später mit nicht weniger schwarzem Sinn für die Abgründe der Moral. Doch während Gracián die Heucheleien seiner Mitmenschen am Ende geißelte, lässt López sie unkommentiert. Ungerührt lässt er die Unterhaltungen dahinplätschern, ohne einzugreifen. So wird es umso offensichtlicher, dass nicht das von Belang ist, worüber, sondern dass überhaupt gesprochen wird. Das Gespräch lenkt ab, wirft entscheidende Fragen nicht auf, sondern unterläuft sie, weshalb es nicht abbrechen darf und einen zentrifugalen Charakter annimmt, von Thema zu Thema eilt.
Entsprechend hoch ist das Tempo, in dem Lopez den Dialog über 180 Seiten hält, deren schwarzer Humor seinesgleichen sucht. Dass er auch im Deutschen so prägnant daherkommt, verdankt sich ganz wesentlich der Übersetzung Susanna Mendes. Sie hat das spanische Original in eine kunstvoll lapidare Sprache übertragen, eine Sprache, die zeigt, dass nichts banaler als das Böse ist.
KERSTEN KNIPP
Carlos Eugenio López: "Abgesoffen". Roman. Aus dem Spanischen übersetzt von Susanna Mende. Verlag Kein & Aber, Zürich 2006. 190 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
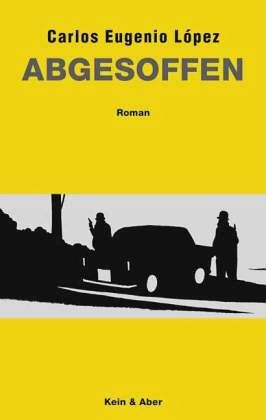




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.06.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.06.2007